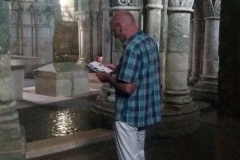Vom 11. bis zum 31. August 2017 machten wir Ferien in dem kleinen Ort Le Chay im Mündungsgebiet der Gironde, die sich bei Royan im Atlantik zu verlieren beginnt. Auf der Hinfahrt (mit dem Auto) übernachteten wir in Orléans, auf der Rückfahrt in Troyes. Wenn man die kürzeste Route wählt, was wir auf der Rückfahrt in etwa getan haben, hat die zu fahrende Strecke ein Länge von etwas mehr als tausend Kilometern. Solche Angaben scheinen irgendwie wichtig zu sein, also machen wir sie ohne zu murren. Apropos Quantifizieren und Qualifizieren: Wo sind wir eigentlich gewesen? Wenn wir in Karlsruhe sind, wissen wir als Eingeweihte, dass wir uns in Nord-Baden, in der Rheinebene am Rande des Schwarzwalds und im Bundesland Baden-Württemberg befinden. Als wir in Le Chay waren – wo waren wir da sonst noch? Wikipedia sagt: in der Region Nouvelle-Aquitaine (die gibt es erst seit 2016), im Département Charente-Maritime (die Charente ist ein Fluss), im Arrondissement Saintes (Saintes ist eine Stadt), im Kanton Saujon (der nächstgelegene größere Ort) und in der Saintogne (die Kulturlandschaft rund um Saintes).
Wie immer haben wir den Reisebericht gemeinsam verfasst und zusammen zusammenfotografiert.
Freitag, 11. August 2017
Bis wir loskamen, wurde es halb eins – bis wir in Orléans ankamen, halb acht. Es wäre übertrieben zu sagen, wir stellten den Tempomat eine halbe Stunde nach Beginn der Fahrt auf 135 km/h ein und setzten ihn kurz vor dem Erreichen unseres Tagesziels durch leichtes Treten des Bremspedals wieder außer Funktion. Aber so ähnlich war es. Mit Hilfe der Google-Lotsin fanden wir zu guter Letzt auch noch vollkommen mühelos unser Hotel (Le Bannier) am Rande der Altstadt. Sie ist wirklich ein Schatz. Hat man sich erst einmal an ihre (im deutschen Sinne) wörtliche Aussprache der französischen Straßen- und Ortsnamen gewöhnt, will man nicht mehr ohne sie leben – mittlerweile haben wir auch verstanden, was sie meint, wenn sie „Er-Jü-E“ sagt, es ist die in Einzelbuchstaben zergliederte Version von „Rue“. Allein bei „Orléans“ enttäuschte sie uns ein wenig und verwechselte offenbar die Stadt an der Loire mit deren Neugründung am Mississippi. Dabei wollte sie es doch nur ausnahmsweise einmal richtig machen.
Das Hotel lag, so glaubten wir zunächst, in einer forensisch bedenklichen Gegend. Was aber nicht der Fall war – sieht man einmal davon ab, dass womöglich ganz Orléans eine forensisch bedenkliche Gegend ist. Nachdem wir unser Zimmer Nummer 8 im zweiten Obergeschoss bezogen hatten, spazierten wir zur Kathedrale. U. wollte ihrer Whats-App-Family-Group etwas zum Raten geben und schickte ein Foto derselben (der Kathedrale, nicht der Gruppe) in die Runde mit der Frage: Wer weiß, wo wir sind? Antworten wie „Frankreich“ kamen der Sache schon ziemlich nahe. Allein die Tante wusste es noch genauer und war sich ihrer Sache auch absolut sicher: Da das die Kathedrale von Reims sei, weilten wir ganz offensichtlich in Reims! Von U.s Beteuerungen, dass wir tatsächlich nicht in Reims, sondern in Orléans seien oder weilten, ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen: Wer die Kathedrale von Reims fotografiert, kann nicht in Orléans, sondern muss in Reims sein. Es war U. also wider Erwarten gelungen, in Orléans die Kathedrale von Reims zu fotografieren – wie, das wissen die Götter oder die Jungfrau von Reims. Oder von wo gleich?
Auf dem Rückweg ins Hotel kamen wir in einer kuschelig viertelkreisförmigen Seitengasse an einer Reihe von Restaurants mit Bewirtung im Freien vorbei. Wir nahmen Platz und aßen gut und nicht besonders teuer Risotto mit Jakobsmuscheln (U.) und etwas Rundes und Flaches, das man in Deutschland für typisch italiänisch hält. L. bekommt jedesmal, wenn er es auf einer Speisekarte entdeckt, Appetit darauf, hat aber dann ebenso jedesmal nach dem dritten Bissen genug davon. So auch an diesem Abend in Reims oder Orléans oder wo oder was. (Also Pizza schmeckt eigentlich nur an kalten Winterabenden nach der Erledigung von Weihnachtseinkäufen im Stehen an einer Straßenecke kurz vor halb acht. Und sie muss viertelkreisförmig kuschelig, halbwegs heiß und gut durchgeweicht sein.)
Samstag, 12. August 2017
Wir hatten trotz der französischen Wackel-Matratze und der einen großen mehrlagigen Gemeinschaftsdecke erstaunlich gut geschlafen. Das Frühstück war angenehm bodenständig-familiär. Kein aufgedonnertes Frühstücksbuffet, bei dem man vor lauter Auswahl nicht ein noch aus, geschweige denn weiß, was man jetzt eigentlich frühstücken möchte. Nein: für jeden gab es ein Croissant und viel Baguette, dazu Butter, zwei Sorten Marmelade und natürlich Orangensaft und Tee oder Kaffee, letzterer sehr stark mit einem Krüglein Milch zum Selber-au-Laitieren, so man denn mixen wollte. Die forensisch unbedenkliche Gegend zeigte sich also von ihrer besten Seite. So auch der Chef des Hauses, ein Charmeur Ende dreißig, von dem U. meinte, sie sehe ihn jetzt schon vor sich, wie er in dreißig Jahren mit grauen Haaren und dickem Bauch und im besten Sinne servil um seine Gäste herumscharwänzeln werde.
Die Fahrt von Orléans nach Saintes, wo wir die Autobahn verließen, war das Gegenteil der Fahrt am Vortag: sehr viel Reiseverkehr und immer wieder Staus. In Saujon (das Städtchen zum Dörfchen Le Chay, in dem unser Häuschen stand) gingen wir erst einmal einkaufen in einem der bombastischen französischen Supermärkte.
Nach Le Chay führen viele Wege, das war schon bei der Anfahrt zu bemerken. In Le Chay selbst gibt es auch sehr viele Wege. Diese Gemeinde mit ihren knapp 800 Einwohnern ist eine chaotisch in der Landschaft verteilte Ansammlung von Unterdörfchen. Wo das eigentliche Le Chay liegt, ist nicht so einfach zu sagen. Dank der Befragung eines Einheimischen in der Landessprache gelingt es L., die richtige Straße zu finden. Wie sich später herausstellt ein Glückstreffer, denn wir fanden in den ersten Tagen unser Domizil nicht immer im ersten Anlauf.
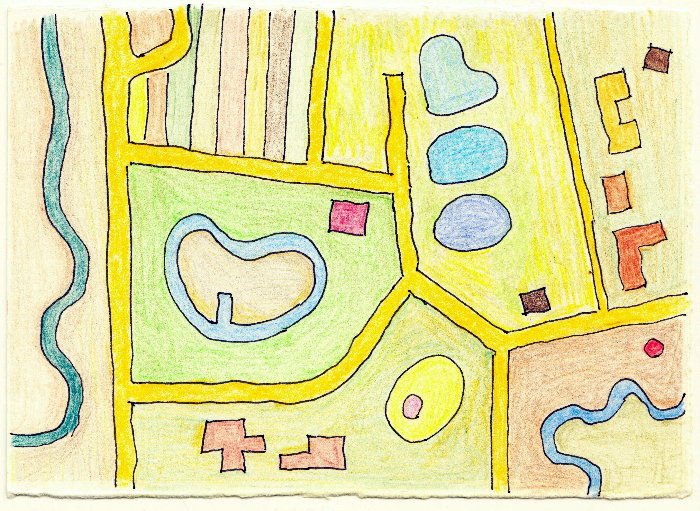
L. u. U.: „Wir sind da, aber wo ist Le Chay?“, 2017, Farbstift, 10,5 x 15 cm
Ein Glückstreffer ist auch der Anbau eines größeren Hauses, den wir für die nächsten zweieinhalb Wochen bewohnen werden. Ein reizendes saarländisch-französisches Ehepaar hat sich nach Rentenbeginn hier niedergelassen, um einen wahrhaft riesigen Park zu pflegen und zu bewirtschaften. Beim ersten Rundgang schaffen wir es nicht einmal bis zur hinteren Grundstücksgrenze.
Unser Häuschen war wohl ursprünglich ein Stall mit Vorbau. Durch Einziehen einer Wand wurde aus dem Stall ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, beides recht klein. Wenn man gewollt hätte, hätte man es so einrichten können, dass ein Doppelbett Platz gefunden hätte. Hätte, hätte. Es gab aber offensichtlich andere Prioritäten. Das Ergebnis der Innenraumgestaltung waren zwei Einzelbetten. Auf der Internetseite wurde das zwar erwähnt, doch U. und L. wähnten sich sicher, dass man die Einzelbetten schon irgendwie werde zueinander schieben können. Werch ein Illtum! Fest eingebaut sind sie und unverrückbar. Entsetzlich. Im Wohnzimmer aber gibt es ein ausziehbares Schlafsofa. Am Abend wird es ausgezogen. U. muss doch in L.s Armen einschlafen.
Sonntag, 13. August 2017
U. erwacht im Morgengrauen mit grässlichen Rückenschmerzen, das Sofa war bretthart. Sie nimmt ihre diversen Kissen samt Decke und zieht in ihr Einzelbett um. L. hat hervorragend geschlafen und lobt die Unnachgiebigkeit der Unterlage.
„Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, wo bist du, wo sind eure Wagen“, so oder so ähnlich sang in einer Zeit, die längst vergangen ist, und in der es noch sogenannte Schlager gab (und in der man die, die sich selbst Zigeuner nennen, noch Zigeuner nennen durfte) eine sogenannte Schlagersängerin, die sich Alexandra nannte (hier bis zum Eintreffen der Sprachpolizei noch auf Youtube). Heute hätten wir es ihr sagen können: Die meisten von ihnen sind wohl auf einem Feld bei Le Chay im Mündungsgebiet der Gironde. Eine solch große An- und Versammlung Fahrenden Volks ist auch im Nachhinein noch der Rede wert: Es werden gewiss mehr als hundert moderne Zigeuner-Wagen gewesen sein, die ganz in der Nähe zu einem Sinti-und/oder-Roma-Pow-Wow zusammenströmten, während wir uns anschickten, zu einer ersten kleinen Tagestour aufzubrechen.
Eigentlich wollten wir in hohem Bogen an der Mündung der Gironde entlang von Südosten her kommend nach Royan hinein fahren. Doch in Talmont (→Wikipedia) blieben wir mehr oder weniger versehentlich hängen. Wenn es das Örtchen nicht schon gäbe, hätte man es zum Zweck der touristischen Bewirtschaftung erfinden, das heißt: erbauen müssen. Was das einmal war, lässt sich ohne Kenntnis der Historie kaum sagen. Was es jetzt ist, schon eher: ein Konglomerat aus niedrigen Gebäuden älterer Bauart, durchzogen von einem halben Dutzend oder mehr Gassen – ein Nest, in das sich Kunsthandwerker, Klamotten- und Gemischtwarenhändler, aber auch etliche Eisdielen und Restaurants eingenistet haben.
Ganz am Rand, auf dem Hochufer über der Gironde-Mündung steht eine romanische Kirche mit anliegendem Gottesacker. Einige hundert Menschen gingen da hin und her, wir hörten sie Englisch und Französisch sprechen, aber nicht Deutsch. U. nutzte die sich bietende Reit-Gelegenheit, um ein paar Runden auf einem nach den Vorgaben der Karussell-Mechanik auf und ab bewegten Apfelschimmel zu drehen. Übrigens scheinen die Franzosen Karussell-Fans zu sein, denn sie (nicht nur die Franzosen – auch die Karusells) begegneten uns sozusagen auf Schritt und Tritt:
Royan konnte noch warten, L.s Schädelrasur nicht, denn sein Haar (also das, was davon übrig ist) hatte bereits die bedenkliche Länge von drei bis vier Millimetern erreicht – da war Eile geboten. Das Aufregende an der Sache: Es musste in Ermangelung einer Haarschneidemaschine (zuhause vergessen) erstmals nass mit Rasierschaum, mithin sozusagen von Hand rasiert werden.
U. übernahm das und erledigte ihre Aufgabe virtuos. Sie hatte ihren L. noch gefragt, ob sie nicht lieber ihren eigenen Nass-Rasierer benutzen solle, der habe einen flexiblen Klingenaufsatz, um besonders empfindliche Stellen zu rasieren. L. entgegnete, sein Haupt sei das Allerempfindlichste, was frau sich nur vorstellen könne. Und entschied, dass die Raseuse doch bitte den neugekauften, mit starrem Kopfteil ausgestatteten Rasierer benutzen solle. Männliche Logik ist manchmal für das andere Geschlecht ebenso leicht verständlich wie im umgekehrten Fall die weibliche. U. jedenfalls arbeitet sich höchst konzentriert und mitunter schwer atmend mit starrer Klinge über L.s empfindlichen Kopf und schafft es ohne Blutvergießen.
Die neue Yul-Brynner- oder Telly-Savalas-Qualität von kahlrasierter Glätte oder glatter Kahlrasiertheit beeindruckte L. zutiefst. So wollte er das jetzt immer haben. Jeden zweiten oder dritten Tag würde von nun an eine Schädel-Nass-Rasur eingeplant werden müssen.
Montag, 14. August 2017
Nach der Erfahrung mit dem wehen Rücken schliefen wir in getrennten Betten. U. träumte nachts prompt, L. habe sich eine Eheauszeit genommen, wohne in einer vollkommen billig und geschmacklos eingerichteten Wohnung und dies auch noch mit einer anderen Frau zusammen. Ungeheuerlich. Zur Rede und vor das übliche Ultimatum gestellt, entscheidet sich L. für das (die) Richtige, der Traum endet. Das Einzelbettenschlafen ist also auch keine Lösung. U. hat die Wahl zwischen Rückenschmerzen und Abtrünnigkeitsträumen.
Ein häuslicher Tag. Wir schieben die Holzliegen, die am oberen Ende mit großen Rollen ausgestattet sind, hin und her, immer schön dem wandernden Halbschatten hinterher, den die drei Palmen und der Feigenbaum werfen. Ein Windchen fächelt sanft, was braucht man mehr?
U. testet am Nachmittag den Pool, der ausdrücklich nur zum Schwimmen gedacht ist (in Großbuchstaben auf der Informationsseite zum Häuschen). Also: keinesfalls nur Planschen! (Plantschen? das klingt noch spritziger). Das Wasser kommt aus einer Quelle und ist angenehm temperiert, der Pool himmelblau, wie es sich gehört. U. schwimmt einige Male hin und her, oh, wie ist das schön! Sie ist sich auch sicher, dass das etwas für ihren L. wäre. Der jedoch erklärt: „dieses Plantschbecken ignoriere ich!“ Dabei ist es ja eben gerade kein Plantschbecken.
L. ignoriert den Pool dann doch nicht wirklich, sondern dreht einen Kunstfilm, in dem der Pool oder das Wasser oder die Sonne oder die Schatten und Lichtreflexe (wer wollte das entscheiden) die Hauptrolle spielt oder spielen:
Der Abend ist schwül-warm. Zum zweiten Mal suchen wir das Super-U in Saujon auf. Weine noch und noch und keine Ahnung, welcher davon wirklich schmecken könnte. Beim Weißen wurde L. zuletzt beinahe blind fündig. Allein der Rote wollte nicht wirklich schmecken. Wir logieren unweit Bordeauxs, also sollten wir womöglich einen Bordeaux kaufen?
Dienstag, 15. August 2017
Wir probieren es mit einem Kompromiss, einem Sowohl-als-auch. U. schläft in L.s Armen in dessen Bett ein und wechselt irgendwann des Nachts ins eigene. Keine Rückenschmerzen, L. wird nächtens nicht abtrünnig.
Feiertag auch und vor allem hierzulande: Mariä Himmelfahrt. Erst am Nachmittag fahren wir die paar Kilometer nach Saujon, um dort bei einem Spaziergang zu sehen, ob es etwas zu sehen gibt. Aus der Nähe betrachtet erweist sich Saujon als eben der leicht schäbig und ärmlich wirkende Ort, welcher er aus der Ferne (nämlich aus dem Auto) betrachtet zu sein schien. Die Kirche ist von geradezu mustergültiger Erbarmenswürdigkeit. Ein Notbehelf aus dem 19. Jahrhundert mit ein paar Resten der romanischen Vorgängerin, die die Revolution nicht überlebt hat. Insgesamt ist dieses Gotteshaus kaum mehr als eine Sammelstätte scheußlichster Scheußlichkeiten. Eine der beiden Seitenkapellen dient offenbar als Rumpelkammer. Man muss schon sehr katholisch sein, um jeden Sonntag (um von den Werktagen nicht zu reden) den Weg hierher zu finden. Doch es scheint sie zu geben, die Gläubigen, die nicht nur keinen Weg, sondern auch kein Ziel scheuen, denn schon aus zwanzig Metern Entfernung konnten wir den Geruch von Weihrauch wahrnehmen, der durch die weit offen stehende Tür ins Freie drang. Möglicherweise liegt es an den Weihwasserbecken, die das Erstaunlichste an der ganzen Kirche sind: zwei gigantische Muscheln, von denen wir erst gar nicht glauben können, dass sie echt sind. Sind sie aber.


Saujon am Sonntagnachmittag
Les Fleures de la Misère: Rührend die Plastikgeranien in ihren Plastikkästen vor einem Haus, unverblümter gesagt: einer Behausung in einer der Seitengassen. Und dann die handgestrickten „Übertöpfe“ oder Haltevorrichtungen, mit deren Hilfe man auf der Haupteinkaufsstraße Blumentöpfe an den Straßenlaternen und sonstwo befestigt hat!
Mittwoch, 16. August 2017
Nach Mittag (nein: nicht am Nachmittag, sondern nach dem Mittagsläuten, wozu noch etwas gesagt werden muss) Aufbruch zur Côte Sauvage nördlich von Royan. Nach etwa einer Stunde (in Ätna einer Stunde kommt meine Tante zu Vesuv) und dem Erklimmen einer hohen Sanddüne (recht anstrengend, U. wünscht sich ein Kamel) erreichten wir das südliche Ende eines langen Sandstrands.
Herrlich! Diese Weite, die Wellen, der Wind, ach! U. möchte am liebsten eine Stunde in die eine und dann wieder zurück in die andere Richtung spazieren. L. verweist auf seine außerordentlich empfindlichen Füße (das Zweitempfindlichste überhaupt?) und sagt, er könne nicht so lange barfuß gehen. Seine ihm Angetraute meint, er solle sich nicht so anstellen, der Sand sei samtzart, so fein wie er sei. L. gibt zu bedenken, dass er mit sogenanntem Sandpapier schon ganz andere Oberflächenschichten weggeschliffen habe als die Haut seiner Füße.
Wir gingen also ein Stück Richtung Norden, wagten uns kurz ins Wasser (Schwimmen gefährlich) und gingen wieder zurück. Bis auf zwei Surfschul-Klassen gibt es keinerlei „Bewirtschaftung“, vom Surfunterricht und dem einen Imbissbuden-Café beim Parkplatz einmal abgesehen. Der Ort wäre ideal für einen Badeurlaub, falls man auf den Strandrummel mit Bewirtung, Bespaßung, Verkauf und so weiter keinen Wert legt. Zurück über Royan, Saujon, Einkauf in unserem Supermarkt.
Ach so, ja – das Mittagsläuten. In Le Chay gönnt man sich den Luxus eines Repetitionsschlagwerks. Das heißt, kurze Zeit, nachdem die Kirchturm-Uhr, sagen wir: zwölf geschlagen hat, schlägt sie gleich noch einmal zwölf Mal. Wir vermuten, damit diejenigen, die beim ersten Mal nicht mitbekommen haben, welches Stündlein ihnen geschlagen wurde oder hat (und die keine Lust haben, aufs portable oder mobile zu sehen), beim zweiten Mal (jetzt sind sie ja darauf gefasst) von Anfang an mitzählen können. Damit ist all jenen, die nicht bis drei zählen können, allerdings nur um ein und um zwei Uhr geholfen. Bei Wikipedia heißt es, diese Schlagwerke seien vor allem in Süddeutschland und in der Schweiz weit verbreitet. Der Fall ist also klar: Der aus Bayern stammende Holzbildhauer Jürgen Lingl-Rebetez, von dem weiter unten noch die Rede sein wird, hat die Uhr aus seiner alten Heimat mit an die Gironde gebracht. Sehr wahrscheinlich hat er, bevor er in die Nähe von Royan gezogen ist, in Le Chay gewohnt. Logisch – oder etwa nicht, Watson? Vollkommen logisch, Mister Holmes, Sir.
Donnerstag, 17. August 2017
Das nächtliche Umziehen von Bett zu Bett war U. dann doch lästig, wir probierten es also wieder mit dem schwedischen Hartsofa, verwendeten allerdings Stuhlauflagen zur Rückenschonung. Jedoch ist es bei einer Breite von etwa 1,20 recht eng, weswegen man beim Umdrehen meistens an die Sofawand oder den anderen Schläfer stößt. U. zieht deshalb bei Morgengrauen wieder um. Insgesamt aber eine Verbesserung: Sie hat weder Rückenschmerzen noch Träume mit billigen Wohnungen. Bon!, wie man hier sagt. Nur L. erwacht mit einem Schock, weil U. nicht da ist.
U. fährt am Abend mit unseren Herbergseltern in deren fünfzehn Jahre altem schönen Rover zu einem Bauern, der dreimal in der Woche auf seinem Hof eigene Produkte verkauft. „Englische Noblesse gepaart mit der Technik von BMW“, so die gebürtige Saarländerin und Wahl-Französin. Misslich sei nur, dass Rover ein Jahr nach dem Kauf des Autos Pleite gegangen sei. Nunmehr ist dieses wunderbare Auto 15 Jahre alt und hat 240.000 km auf dem Blechbuckel. Ersatzteile bekomme man nur noch über Schrottplätze, weswegen sie ständig befürchtet, dass ihnen jemand eine Ecke abfährt. Letztes Jahr sei Ihnen jemand in die Tür gefahren und es habe zwei Wochen gedauert, bis die Ersatztür da war. Ein Wimpernschlag, wenn man U.s und L.s leidvolle automobile Erfahrungen (ebenfalls letztes Jahr) bedenkt.

L. u. U.: „Tolle Tomate“, 2017, Farbstift, 10,5 x 15 cm
U. kehrt zurück mit vier Monster-Tomaten, zig Bohnen, fünf Kartoffeln und einem Salatkopf.
Sie erfährt von Frau B., dass ihr Mann keinerlei Obst isst und keinerlei Gemüse – bis auf Kartoffeln. Salat natürlich ganz und gar nicht. Tags zuvor hatte sie uns etwas Köstliches hingestellt: mit Knoblauch eingeriebenes Brot, darauf Tomatensoße und zur Krönung oben knusprigen Schafskäse, alles gewürzt mit Kräutern aus dem Garten. Das war von ihrem Mittagessen (das sie um 11 Uhr einnimmt) übrig geblieben. Ja, so etwas esse ihr Mann auch nicht, da sei ja Käse drauf. U. traut sich nicht zu fragen, was ihr Mann denn überhaupt isst, vielleicht weil sie insgeheim befürchtet, dass die Antwort „am liebsten Feriengäste“ lauten könnte.
Freitag, 18. August 2017
Der Tag begann mit ergiebigem Regen, der erst gegen zwei Uhr aufhörte. Also blieben wir erst einmal drinnen. Um uns dann zu entschließen, das Haus nicht zu verlassen. Irgendwann fuhren wir zum Einkaufen zum Super-U (bei Royan hatten wir zwei Tage zuvor ein oder einen Hyper-U entdeckt). Am Abend stießen wir beim Zappen auf einen Film von Hitchcock: „Der zerrissene Vorhang“ (1966). Was für ein Käse, wenn man das im Land desselben sagen darf! Eine im Stil der 1930er Jahre gehaltene Absurdität mit deutlich erkennbar im Studio gedrehten „Außen“-Aufnahmen und KAMERAEINSTELLUNGEN mit drei cinematologischen Ausrufezeichen. Einige Szenen waren wohl als Stummfilm-Zitate gemeint. Da wir offenbar doch keine wirklichen Cineasten sind, konnten wir darüber nur den Kopf schütteln, statt vor Begeisterung den Flatscreen zu umarmen.
Samstag, 19. August 2017
Nach dem Frühstück, also gegen 13 Uhr, machten wir uns auf den Weg ins uns wärmstens empfohlene Saintes – zunächst in Luftlinie diagonal über Land bis wir auf die von Saujon kommende Schnellstraße stießen. Wir fuhren von Süden her in das Städtchen hinein, wodurch man als ersten Eindruck den eines ländlich geprägten und eher unspektakulär-langweiligen Ortes bekommt. Auch nachdem wir gleich den ersten der ausgewiesenen Parkplätze am Ufer der Charante angesteuert hatten und zu Fuß zur nahegelegenen romanisch-gotischen Kirche gegangen waren, änderte sich daran wenig.
Ein anderes Bild ergab sich erst, als wir uns dem Stadtzentrum näherten. Da gab es dann mit einem Mal und wie aus dem Nichts Menschen und Verkehr, Fahnen und eine Stadtbibliothek (die geöffnet hatte), Cafés und eine Porta Blanca aus römischen Zeiten, Geschäfte entlang einer schönen und schnurgerade langen Platanen-Allee, ein Karussell und so weiter und so weiter. In einem der Cafés tranken wir ziemlich schlechten Kaffee, sehr stilles Wasser und aßen dazu ein sehr leckeres, frisch getoastetes Panino mit Käse, Schinken und Tomate.
Und zu guter Letzt wurde uns gar noch das Spektakel einer Hochzeit geboten: In der anderen gotischen Kirche war die Trauungszeremonie eben zu Ende gegangen und die Hochzeitsgesellschaft umringte vor dem weit geöffneten Portal das Brautpaar. Alle waren feierlich und höchst elegant gekleidet. Die Herren ausnahmslos in Anzügen aus herrlichem Stoff von grau über blau bis schwarz, was für eine Augenweide. U. möchte ihren L. auch mal wieder in einem Anzug sehen. Die Damen in eleganten Kleidern, gewiss ebenfalls nicht von der Stange, einige gekrönt von extravaganten Hüten. Ein älterer, mit Bändern geschmückter grünlicher Rolls Royce stand für die Frisch-kirchlich-Getrauten bereit, doch das Bisounieren, Herzen und Scherzen wollte kein Ende nehmen. L. mochte nicht länger warten und drängte zur Rückkehr zum grauen Volkswagen ohne Bänder. Doch auf dem Weg dorthin wurden wir dann doch und sogar noch von der Hochzeits-Blech-Kutsche überholt. Ende gut, alles gut.
In Saujon kauften wir in einer Boulangerie, die am Wege lag, deux baguette und deux tartes aux pommes, wobei die nicht unansehnliche Bäckerin (L. wähnte, es war wirkliche eine Bäckerin und nicht nur eine Backwarenverkäuferin) L.s Wunsch nach „deux tartes aux pommes“ eigenmündig wiederholte und dabei das „po“ von „pommes“ so aussprach, wie es sich hierzulande gehört, nämlich ohne Aspiration beim p, das ein wenig wie ein b klingen muss (mit hohl-voluminösem o): ein Ohrenschmaus als Zugabe zum Augenschmaus. Superb! Hören und Sehen wie ein Gott in Frankreich!
Sonntag, 20. August 2017
Unsere Frühstücke finden in Anbetracht der schlechten Netzverbindung ohne Radio statt. Die Verbindung über das Funknetz ist sehr instabil, der WLAN-Router befindet sich im Haupthaus, routet aber wegen der neunzig Zentimeter dicken Mauern nur direkt vor der Küche unserer Herbergseltern. Also bleiben die Flipbox samt Ladekabel ungenutzt im Koffer. Für U.s internen Gehirnplayer hat das sein Gutes, er wird immer leiser und ton-karger – keine Ohrwürmer, keine ungefragt von selbst laufende Musik. Wir hören also nur Naturgeräusche.
U. erinnert sich an Peter Handkes „Versuch über den Pilzsammler“, in dem er die verschiedenen Arten des Baumrauschens beschreibt (wunderschön übrigens). Weiter weg rauschen die Pinien. Ein Baum, von dem wir nicht wissen, was es ist (i. e.: wie er heißt), raschelt. Er beginnt schon mit dem Blattabwurf, was ein helles Knistern hervorruft, wenn die fallenden Blätter auf andere Blätter fallen. Uns völlig neu ist das Knattern der Palmen – es klingt so ähnlich wie das Knattern von schlagenden Segeln. Ab und an macht es „plop“, wenn ein Apfel fällt, die Feigen wiederum gehen mit einem etwas weicheren „plumps“ zu Boden.

L. R. „Blätter in Le Chay“, 2017, Tablet-Zeichnung
Fast wie zu Hause machen die Lachtauben ihr wiederholtes „Hu-huu-hu“ (Achtel-, punktierte Viertel-, plus Sechzehntel-Note), mit französischem Akzent. Zwischen zwölf und eins gibt es täglich erregtes Hundegebell: ein Hoch- und ein Tief-Beller echauffieren sich gemeinsam jeweils etwa eine Stunde lang. Worüber? Rätselhaft. Wir vermuten, sie bellen eine sich in aller Ruhe zwischen den Hoftoren putzende Katze an.
Montag, 21. August 2017
Herrlichstes Wetter, herrlichstes Nichtstun. Wir rollen die Liegen von hier nach da, wenden uns von vorne nach hinten, lesen unsere Bücher, U. rätselt zwischendurch ihre Sudokus. Nach Mittag, man kann es kaum anders sagen: schleift U. ihren Angetrauten zum Quellwasserpool und zwingt ihn geradezu, mit ihr zusammen einzutauchen. Er zelebriert das Stück-für-Stück-Eintauchen ins eisige Nass genussvoll leidend. Ein umhertreibendes Objekt entpuppt sich als Thermometer, das 29 Grad Wassertemperatur anzeigt. Wahrhaft eisig. L. muss auf Nachfrage zugeben, dass seine Angetraute Recht hatte, was ihn und den Pool betrifft: dass es für ihn nämlich durchaus nicht unangenehm sein würde, sich darin aufzuhalten. Er setzt noch eins drauf und stellt sich vor, wie wundervoll es erst im Winter sein müsse, bei quellwasserwarmen 29 Grad zu schwimmen, und wie märchenhaft es dann wäre, wenn es anfinge zu schneien und es unter dem Glasdach wegen des darauf liegenbleibenden Schnees allmählich immer dunkler würde. Es ist Sommer, eindeutig. Das erkennt man daran, dass L. sich auf Weihnachten freut und Schneeflocken herbeisehnt.
Endlich war dann noch L.s zweite Kopfrasur fällig. U. schabte sorgfältig und gründlich. „Happiness is“, wie es in einem Song der Beatles heißt, „a worm gun“, aber, insbesondere wenn Mann in die Jahre kommt, mindestens ebenso glücklich machend ist ein frisch rasierter Schädel! Wer hätte das gedacht. Es ist vergnüglich, sich einmal die unterschiedlichen Coverversionen des 1968er Gun-Songs der Beatles anzuhören. Meine Nummer eins ist diese mit Joe Anderson (den Damenchor im Hintergrund hat er sich von Leonard Cohen ausgeliehen), kaum wiedererkennbar ist der Song hier mit The Breeders. Auch gut das hier mit dem Wild Honey Orchestra – man sehe und höre im Vergleich dazu diese verbeliebigte Fassung mit Gavin DeGraw, dem es völlig egal ist, was und wovon er singt (man sieht und hört genau: er überlegt gerade, ob der morgige Auftritt in Boston oder in San Francisco sein wird). Wovon singt er eigentlich? Unter den Einsendern der richtigen Antwort verlosen wir eine Packung Präservative (im Kontext passender: „Pariser“).
Dienstag, 22. August 2017
Es ging uns hier an der Mündung der Gironde nicht besser als zuhause am Rhein: Auf die Internet-Wettervorhersage war kein Verlass. Vom Nachmittag an sollte es angeblich heiß und sonnig sein. Geplant hatten wir einen Ausflug an den Strand, unsere „Nachbarn“, die B.s, waren schon um elf (gleich nach dem Mittagessen) dorthin aufgebrochen. Als sich zeigte, dass die Wolkendecke nicht aufreißen wollte, beschlossen wir, zuhause zu bleiben. Nichtstun ist schließlich auch anstrengend genug.
Die B.s kehren gegen halb sechs vom Strand zurück. Das Meer sei gar nicht schön gewesen, aufgewühlt und das Wasser nicht klar. Außerdem sei sie (Frau B.) jetzt so durchgefroren, das sie ein heißes Bad benötige. U. ist bei bedecktem Himmel den ganzen Tag im Bikini draußen und wundert sich abends, dass ihre Schultern gerötet sind.
Am Abend fuhr L. alleine zum Einkaufen. Und holte dort für uns Crevetten, Marmelade und Küchenpapier, für eine Dame dagegen einen Kanister Wein aus einem der oberen Regale. L. hatte zwar nicht verstanden, was sie zu ihm sagte, wohl aber, was er für sie tun sollte – also die klassische Situation zwischen Mann und Frau. Er erledigte seine Aufgabe mit Bravour, einem „voilà“ und einem „de rien“, als sie ihm beglückt ihr „merci“ zulächelte.
Mittwoch, 23. August 2017
Am Mittag machten wir uns endlich einmal auf den Weg nach Royan. Wir hatten keine konkrete Vorstellung davon, was uns in dieser nächsten größeren Stadt erwarten würde. Von Frau B. wussten wir, dass dort jeden Tag Markt ist und von Tante Wikipedia, dass der Ort (genauer: die Ortsmitte) im Januar 1945 von alliierten Bomben komplett zerstört wurde und heute achtzehntausend Einwohner hat – im Nachhinein eine fragwürdige Angabe, denn in Wahrheit dürfte die Einwohnerzahl im Laufe des Jahres erheblichen Schwankungen unterliegen. Aber der Reihe nach.
Wir fuhren, bis es geradeaus beinahe nicht mehr weiterging und parkten bei der zwischen 1955 und 1958 erbauten Kirche (Notre-Dame de Royan), einer Kathedrale in Beton. Ein mächtiger betongrauer Bau (an vielen Stellen offenbar renovierungsbedürftig), außen wie innen gotisch himmelstrebend, mit schönen, vertikal fugenartigen Glas-Streifen-Fenstern in dezenten Farben (sehr ausführlich beschrieben und gezeigt: hier). Aber natürlich hat sich im Lauf der Jahrzehnte allerlei Gerümpel angesammelt: Eine metallene Jeanne d’Arc, die zum Piepen ist; ein Thronsessel aus Holz für die Oberpriester – die Ecken und Kanten anthroposophisch abgerundet, damit sich (wenigstens physisch) niemand verletzt; Glasfenster im Erdgeschoss mit biblischen Szenen in kindgerechter Harmlosigkeit (eine Katze darf nicht fehlen) und so weiter. Eine mit dieser Kirche vergleichbare sahen wir vor Jahren in Le Havre: Saint-Joseph.
Von der Kirche aus fanden wir den Weg leicht hinunter zur Gironde-Mündung. Da erst entpuppte sich Royan als belebter See-Badort mit allem, was dazugehört. In einiger Entfernung zum merkantilen Bade-Betrieb stießen wir auf einen schönen, breiten Boulevard: eine Art in die Länge gezogener Platz, natürlich mit Platanen und rundum laufender Verkehrsführung. Geschäfte wechselten sich ab mit Cafés, wir aßen in einem der letzteren je eine Crêpe und tranken nicht wirklich schlechten Kaffee. Den Winter verbringen die Wenigen, die in der Stadt geblieben sind (und für Einwohnerzählungen zur Verfügung stehen), vermutlich damit, das Silber zu putzen und auf den Sommer zu warten.
Beim Verlassen der Stadt fuhren wir am Ufer der Gironde (das spätestens bei Flut regelmäßig zum Ufer des Atlantiks wird) entlang. Die schönen Strand-Promenaden, zunächst mit prächtigen Villen vom Beginn des 20. Jahrhunderts, wollten kein Ende nehmen.
Donnerstag, 24. August 2017
Nach großen Unternehmungen war uns nicht zumute, aber nach kleinen. Also machten wir uns auf den Weg zu einem Kloster in der Nähe – wir hatten immer mal wieder das Schild gesehen, das zur Abtei Sablonceaux wies.
Mitten in der Landschaft liegt imposant die Abtei, auf dem Parkplatz davor stehen Dutzende von Autos. Sind wir einmal mehr ungewollt an einen touristischen Hotspot geraten? Wenn man so gänzlich ohne Reiseführer unterwegs ist (zwei zentnerschwere gesamtfranzösische Führer hatten wir beherzt zu Hause gelassen), weiß man vorher nie, ob etwa eine Abbaye sehenswert ist oder nicht. Auf größere Menschenmassen gefasst, schreiten wir zur Kirche, kein Mensch ist zu sehen. Rechter Hand eine Boutique: geschlossen wegen Mittagspause. Linker Hand eine öffentliche Toilette, aus der eine Frau zielstrebigen Schrittes hinaus und vor uns in die Kirche tritt. Es war ihr anzumerken, dass ihr das sehr wichtig war.
Die Kirche, wie alles hier aus diesem herrlich hellen Stein gebaut, ist in Teilen renoviert. In den nicht renovierten Ecken verlaufen grüne Wasserstraßen von oben nach unten, Sockel bröckeln, eine in der sonstigen Leere der nicht vorhandenen Ausstattung verloren wirkende Barockorgel staubt vor sich hin. Auch hier kein Mensch. Wo sind nur all die Autobesitzer? Seitlich eine kleine Sammlung von Notenständern, Kabeln und Mikrofonen. Nach einer CD-Aufnahmesituation sieht das Ganze nicht aus. Argwöhnisch beäugt U. einen Notenständer mit Büchern und Heften und findet obenauf ein Kirchenlied „Singing, Jesus, Singing“. Uuuuh, denkt U., selbst hier in einer katholischen Abtei hat sich jener Virus ausgebreitet, der die von ihm befallenen Gläubigen peppig poppige Lieder zur Klampfe singen lässt, womöglich von rhythmischem Händeklatschen gestisch und akustisch unterstrichen.
Vor einer Seitenkapelle liegt auf einem Tischchen ein Gästebuch mit Kugelschreiber. Es ist gut gefüllt, allein in der letzten Woche mehr als zwanzig Einträge. L. versucht für U. zu übersetzen, wird aber durch ein laut gezischtes „Schsch!!“ unterbrochen. Die Dame, die vor uns die Kirche betreten hatte, saß hinter einer Säule verborgen auf dem Boden und fühlte sich gestört. Hatten wir uns mit dem Betreten der Kirche verpflichtet, unter keinen Umständen kaum einen Laut nicht von uns zu geben? Sie war offenbar dieser trappistischen Ansicht.
Wir machen noch einen Schlenker über den benachbarten Gottesacker, es könnte ja sein, dass sich etwas Interessantes findet. Tatsächlich finden wir gleich zu Anfang sehr alte, schmale Steinblöcke auf Steinstelzen, so etwas hatten wir noch nie gesehen. Gräber können es nicht sein (zu klein und vermutlich massiv), aber was ist das dann? L. vermutet: eine ausgefallene Art von Grabsteinen. Die Steine sind dunkel verwittert, alles steht schief und krumm. Immer wieder stellen wir fest, wie ungepflegt aus deutscher Sicht französische Friedhöfe sind. Auch hier: umgestürzte Kreuze, Unkraut, vertrocknete Kübelpflanzen im Wechsel mit verblichenen bunten Plastikblumen – U. bittet wen auch immer um Verzeihung, aber das Ganze sieht aus wie ein Müllhaufen, eine verkommene Deponie. Auch italienische Friedhöfe sind keine Kleingartenanlagen wie die Deutschen sie mögen, hegen und pflegen, aber doch sehr viel gepflegter. (Das musste jetzt einfach mal gesagt werden.)
Eine Tafel belehrt darüber, dass der monastische Komplex 1791 mit Ausnahme der Kirche erst Volkseigentum und danach zum Kauf angeboten wurde. Es dauerte dann allerdings noch knapp zweihundert Jahre, bis die Immobilie 1986 erneut den Besitzer wechselte. Der neue Besitzer war quasi ein Nachkomme der alten: ein Bischof erwarb die Wirtschaftsgebäude, um dort ein christliches Zentrum einzurichten. Katholisch, aber mit ökumenischer Ausrichtung. Man kann hier eine „Retraite“ machen – für sieben Tage oder gleich für einen ganzen Monat.
Wir schweifen noch etwas umher und entdecken in einem der Wirtschaftsgebäude den Eingang zu einem großen Hof, mit einem Gittertor versehen. Hinein und heraus strömen Menschen in heller Kleidung mit Holzkreuzen um den Hals und einem angesteckten Zugangsausweis. Hinter dem Gebäudekomplex herrscht reges Treiben und weiße Partyzelte sind aufgeschlagen. Offenbar sehen wir hier die Teilnehmer eines katholisch-ökumenischen Rückzugsseminars. Ein spirituelles Heerlager, in dem man sich kollektiv und individuell auf ein Letztes Gefecht vorbereitet?
Zurück im Auto umfahren wir das sehr ausgedehnte Gelände, überall im Schatten stehen Campingzelte. U. erinnert das alles ein bisschen an Taizé, wo sie zu jugendbewegt-christlichen Zeiten eine fromme Woche verbracht hat.
Auf der Rückfahrt nahmen wir einen Umweg und landeten in einem kleinen Ort (St.-Romain-de-Benet) mit großer Kirche, welche aber verschlossen war. Ein Mann mit kaputtem Auge, der ganz alleine den Platz vor der Kirche bevölkerte, fragte erst „Vous cherchez quelque chose?“ und versuchte uns dann zu erklären, warum die Kirche zu war. Untröstlich darüber, dass ihm dieses nicht gelang, rief er eine Frau mit zwei ganzen Augen zu Hilfe. Wir ahnten dann, dass diese Kirche (die wohl auch schon einige hundert Jahre gesehen hatte) nicht nur für ein paar Stunden, Tage oder Wochen, sondern schon vor einiger Zeit für längere Zeit geschlossen worden war. Hier der Blick ins Innere, den wir nicht tun konnte. L. nahm es mit dem sprichwörtlich lachenden, U. mit dem dazugehörigen weinenden Auge.
Freitag, 25. August 2017
Eine Bootsfahrt, das wollte U. unbedingt machen. Eigentlich. Auf Frau B.s Sehenswürdigkeitsliste waren uns zwei Schiffsausflüge vorgeschlagen worden. Bei dem ersten, näher liegenden, startet man in Meschers Port zum Phare de Corduan. Erbaut vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, steht er auf einem Felsen mitten im Meer in der Girondemündung, gleichzeitig mit der Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde er zum Weltkulturerbe erklärt. Innen gibt es allerlei zu sehen, vor allem natürlich eine sehr lange und somit immer höher sich windende Wendeltreppe. Das ist gar nichts für L., wie U. weiß, aber sie hofft. Als sie jedoch Näheres erklären muss, unter anderem, dass der Ausflug sechs Stunden dauert (L. hält sechs Stunden für die Besichtigung eines Eilandes mit nichts drauf außer einem alten Turm für ziemlich extravagant), und dass das Ganze 35 Euro pro Person kostet, ist der Fall erledigt.
Der zweite vorgeschlagene Bootsausflug geht von Fourras zur Ile d´Aix, eine verschlafen Insel mit ohne Autos, die man in zwei Stunden unter Pinien umwandern könne. Heute jedoch haben wir eine so lange Ebbezeit (das liegt am Koeffizienten, erklärt uns Frau B., das Meer zieht sich dieser Tage sehr weit zurück), dass zwischen elf und 18 Uhr gar kein Boot fährt. Das letzte Vormittagsboot haben wir verpasst. Außerdem müsste man eine Stunde Auto fahren bis Fourras. Da hat U. heute nicht so viel Lust.
Bis wir uns entschieden hatten, keines der Schiffe zu besteigen, war es zu spät, um überhaupt noch etwas zu unternehmen. Am Pool treffen wir Frau B. zu einem Plausch über dies und das. Mit Blick auf U.s Bauch fragt sie, ob sie sich dies Bäuchlein hier angefuttert habe, oder ob sie etwa freudiger Erwartung sei? L. meint, seine Frau lasse das Bäuchlein gerade infolge einer besonders entspannten Körperhaltung ein wenig raushängen, es sei gar nicht so dick, wie es zu sein scheine. Seine Frau findet das alles ziemlich peinlich und meint zu Frau B., sie sei nun bald fünfzig, da würde sie mit dem Kinderkriegen nicht mehr anfangen und erntet mit dieser Altersangabe immerhin ungläubige Ausrufe.
Frau B. war es wohl auch ein bisschen peinlich gewesen – jedenfalls kommt sie eine halbe Stunde später mit einem Teller in Teig gehüllter und in Fett ausgebackener Apfelscheiben, dick mit Zucker bestreut. „Auf dass das Bäuchlein nicht schmaler werde!“, meint sie fröhlich. U. vertieft sich in ihr Buch und tut so, als habe sie nichts gehört.
Samstag, 26. August 2017
Ein heißer Tag und laut Wettervorhersage sollten noch heißere folgen. Also fuhren wir los Richtung Côte Sauvage, nahmen aber dieses Mal einen anderen Weg, nämlich entlang der Seudre (die durch Saujon und bei Marennes ins Meer fließt). Gleich zu Beginn machten wir, um L.s Neugier zu befriedigen, einen Abstecher nach Mornac-sur-Seudre. Wider Erwarten stießen wir dort auf ein anderes Malerdorf. „Galerie“ reihte sich an „Galerie“ – das übliche, am vermeintlichen Geschmack des Publikums orientierte Zeug. Dennoch war der Ort hübsch anzusehen, sehr gepflegt, keine verlotterten Ecken, viele bunte Blumen in Kübeln und Kästen, die Wände leuchtend weiß, die Fensterläden blau: eine griechische Enklave an der französischen Atlantikküste. Wir gingen noch ein Stück Richtung Seudre durch eine holländisch anmutende Landschaft, nur die Windmühlen fehlten noch: ein von Kanälen (die sich bei Flut mit Wasser füllten – es war Ebbe) durchzogenes Gebiet mit künstlich angelegten Becken für die Austernzucht. Wenn schon Enklave oder auch Fata-Morgana, dann also eine griechisch-holländische. Nach einer knappen Stunde regionaler Mehrdeutigkeiten kehrten wir nach Frankreich zurück, indem wir unsere Fahrt an die Côte Sauvage fortsetzten.
Bei auflaufender Flut lagen wir endlich, nachdem wir kurz im trüben Wasser gewesen waren, gut zwei Stunden am Strand. L. döste oder ging ein wenig auf und ab, abwechselnd das Meer, die Meerjungfrauen und eine tote Möwe betrachtend. U. lag mit dem Kopf unter dem neu gekauften Strandschirm mit Silberbeschichtung an der Unterseite. So kommt wohl keine Sonne durch, leider aber auch keine Luft, senkrecht gesehen. Zwar weht ein Wind von rechts nach links, aber von oben drückt es heiß auf U.s Haupt. Eine seltsame Sache, diese Unterseitenbeschichtung.

Die Côte Sauvage nördlich von Royan
Sonntag, 27. August 2017
Schon zum Frühstück zeigt das im Feigenbaum installierte Thermometer 31,9 Grad, dazu ist es unglaublich schwül, es geht kein Lüftchen. Bestes Karlsruher Sommerwetter.
Was taten wir? Herumliegen, im Park umhergehen, schwimmen und lesen. L. las zufällig in Nietzsches Zarathustra: „Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, – ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen: man erlebt endlich nur noch sich selber. / Die Zeit ist abgeflossen, wo mir noch Zufälle begegnen durften; und was könnte jetzt noch zu mir fallen, was nicht schon mein Eigen wäre! / Es kehrt nur zurück, es kommt mir endlich heim – mein eigen Selbst, und was von ihm lange in der Fremde war und zerstreut unter alle Dinge und Zufälle.“
Am Abend ein schöner Film auf „arte“ über die Pianistin Clara Haskil (allerdings ohne deutsche Synchronisation der meist Französisch, gelegentlich Englisch Sprechenden).
Montag, 28. August 2017
Das Feigenbaumthermometer zeigt heute zum Frühstück sogar 32,4 Grad. Es scheint uns noch schwüler und noch windstiller als gestern zu sein. U. ächzt und schwitzt schon allein bei dem Gedanken, etwas tun zu sollen. Frau B. bestätigt ihr, dass dieses Wetter gar nicht atlantisch sei, ganz und gar untypisch für diese Region.
Was wir taten? Herumliegen, im Park umhergehen, schwimmen und lesen. L. las zufällig bei Max Stirner („Der Einige und sein Eigentum“, 1845), dass Feuerbach zwar Gott abgeschafft, zugleich aber das Übel des Vergöttlichens „des Menschen“, „der Liebe“, „der Humanität“ und so weiter erst so richtig in Gang gebracht habe. Ganz ohne höhere Mächte leben geht anscheinend nicht.
Am Abend las L. aus Matthias Zschokkes „Ein neuer Nachbar“ vor. In der Erzählung „Brief eines Katzenfreundes“ heißt es: „andere bogen sich vor Wonne zur Brücke und tauchten vorne und hinten im heißen Mus unter, wieder andere stützten sich auf die Seite und zeigten schamlos ihre saftigen Schenkel, daß mir links und rechts Speichel aus den Mundwinkeln quoll. Dazu gab es schweren, tiefroten Wein.“ Die Rede ist von Ossobuco, Kalbshaxen, die sich „in einem dampfenden Brei […] räkelten“. Das passte als Beschreibung allerdings auch hervorragend auf die sich drüben im mittlerweile nächtlich dampfenden Park räkelnde, überlebensgroße Plastik (aus Plastik) des aus Bayern stammenden Holzbildhauers Jürgen Lingl-Rebetez. Hier seine Website. Wer noch nie Französisch mit bayerischem Akzent gehört hat, sollte sich diese hören- und sehenswerte Filme ansehen.
Dienstag, 29. August 2017
Um halb eins Abfahrt zur Isle-d’Aix in der Nähe von Rochefort. Wir nahmen die Fähre um 14 Uhr, gingen kreuz und quer durch den hübschen Ort, aßen Panini und mieteten dann für eine Stunde zwei Fahrräder, mit denen wir eine Inselrundfahrt machten, die tatsächlich eine knappe Stunde dauerte. Dann war es auch schon wieder Zeit für die windig-kühle Rückfahrt mit der Fünf-Uhr-Fähre.
Einkauf in unserem Super-U. Die Super-U. packte danach den großen Koffer, Super-L. suchte Kram zusammen. Am nächsten Tag sollte es super schnell gehen.
Mittwoch, 30. August 2017
Unsere Herbergseltern hören das Rumoren und kommen zum Verabschieden. U. kann nicht länger ihre Neugier bezähmen und fragt Frau B., was sie denn beruflich gemacht habe und fügt ein paar Vorschläge an, die ihr passend zu sein scheinen: Lehrerin, Chefsekretärin eines bedeutenden Industriemagnaten oder Unternehmerin. Mit letzterem lag U. grundsätzlich richtig, ist zu erfahren, denn Frau B. war Antiquitätenhändlerin. Das Rentendasein habe sie übrigens von Anfang an genossen: „Diese Freiheit, keine Sorgen mehr um genügend Umsatz und ausreichend Kunden, herrlich! Aber da haben Sie ja noch ein bisschen Zeit, bis es bei Ihnen so weit ist!“ Als L. seine einundsechzig Jahre gesteht, ist sie noch ungläubiger als bei dem am Pool offenbarten Alter von U. „Nein, also wirklich! Mein Mann und ich waren uns sicher, Sie beide seien zwischen vierzig und fünfzig!“ Nun, bei U. stimmt das doch noch 17 Monate und L. fühlt sich zwar ein wenig geschmeichelt, wäre aber lieber auf Mitte dreißig geschätzt worden. (Was Herr B. beruflich gemacht hat, hätte U. auch sehr interessiert, aber das traute sie sich nicht, auch noch zu fragen).
Um 11:30 Uhr sitzen wir dann also geschmeichelt und mit fast allen 70 Sachen („Schauen Sie noch mal gut nach! Ich schicke nichts hinterher!“, so Frau B.) in unserem Kombigolf und fahren ein letztes Mal eine der vielen möglichen Straßen aus Le Chay hinaus. Es ist kühl und bewölkt, als wollte man uns sagen: Schluss ist’s nun mit der Herumliegerei unter Palmen und Feigenbäumen!
Wie auf der Hinfahrt ist der Verkehr bis Orléans relativ dicht, danach wird es besser und mit Miss Google finden wir problemlos unser Hotel in Troyes. Das Parken in der Altstadt ist nahezu unmöglich, so sind wir froh, dass in der Hotelgarage noch ein Platz frei ist. Das Hotel – nun ja: wir haben ein Bett und eine Dusche.
Beim abendlichen Gang durch die mittelalterlicher Altstadt stellen wir fest: so viel Mittelalter war nie. Man kann ja über die Moderne sagen, was man will, aber im fünfzehnten Jahrhundert leben? Nein danke. Bei einigen der Fachwerkhäuser können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass die jemals gerade und halbwegs „im Wasser“ gestanden haben. Das geht gar nicht – so wie die Balken bemessen und angeordnet sind! Die alten Kirchen sind schon zu, geöffnet sind die Bars, Cafés, Restaurants. In einem uns sympathischen Wirtshaus nehmen wir an einem im Freien neben einer Kathedrale stehenden Tischchen platz. Das dunkle Gewölk am Himmel scheint niemanden zu interessieren, die Troyaner sind so leicht nicht aus der Ruhe zu bringen. Erst als erste Tropfen fallen (es wurde offenbar mit dem Wettergott vereinbart, dass es immer nur ganz, ganz allmählich zu regnen beginnen darf), zieht man sich ins Trockene zurück, und während in der einen Ecke an den Tischen noch gelacht, geflirtet und getrunken wird, baut die Bedienung an der anderen Ecke des kleinen Platzes schon die Tische und Stühle ab. Man könnte meinen, das Stück sei so schon hundert Mal über die Bühne gegangen und alle Beteiligten wüssten genau, wann sie was zu tun haben. Zu guter letzt aber hat der Regen seinen großen Auftritt und es schüttet wie aus Kübeln – aus mittelalterlich-handgefertigten versteht sich.
Donnerstag, 31. August 2017
Nach einem Frühstück, über das man besser kein weiteres Wort verliert, lassen wir Troyes hinter uns. L. hat darum gebeten, dass für die zweite Hälfte der Rückfahrt die Autobahn gemieden und den Landstraßen der Vorzug gegeben wird. Denn er hat das Gefühl, längst noch nicht genug Französisches gesehen zu haben.
Dass hier- oder dortzulande bei der Landstraßen-Nummerierung falsch herum vorgegangen wird, ist gewöhnungsbedürftig. Jedem vernünftigen Menschen muss doch einleuchten, dass den großen Straßen die kleinen Zahlen und den kleineren und kleinsten Straßen die größeren und größten Zahlen zugeordnete werden müssen. Ausgerechnet in dem Land, das sich auf seine Rationalismus-Tradition viel einbildet, ist es genau anders herum. Was die Landschaft nicht daran hindert schön und die Straßen nicht davon abhält, nur wenig befahren zu sein.
Bis in die Gegend südlich von Nancy kommen wir zwar schön und gut, aber mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von um die 70 km/h (die Pausen nicht mitgerechnet) nicht wirklich schnell voran. Für den Rest der Strecke nehmen wir daher gerne die Autobahn, zumal sie, wenn man sich Strasbourg nähert, kaum noch etwas kostet (wir bezahlen für die an diesem Tag gefahrenen 440 Kilometer insgesamt nur 3,50 EUR).
Au revoir et bonne journée!
U. et L.
Fin
P. S.: Wer kann und mag, darf seinen Applaus gerne auf dieses Konto spenden:
Lothar Rumold
IBAN: DE29 6619 0000 0000 3169 70 BIC: GENODE61KA1
oder via PayPal:
paypal.me/LotharRumold

Merci beaucoup!