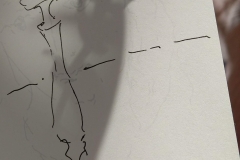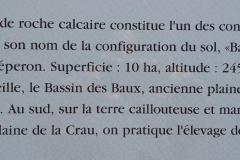Anfang August
In Karlsruhe ist es brütend heiß, seit Wochen kein Regen, die Nächte zu warm, um nachts die Wohnung herunter zu kühlen. Die Innentemperatur hat sich auf knapp 30 Grad eingependelt.
U. hat seit einer Woche Ferien und weiß nicht recht, wohin mit sich. Kaum sitzt sie an der Nähmaschine oder räumt das Arbeitszimmer auf, bricht ihr der Schweiß in Strömen aus. In ganz Karlsruhe gibt es keinen Ventilator mehr zu kaufen, so bestellt sie einen bei Dings, äh, fängt mit A an. Bis der eintrifft, bekommt sie einen der drei Puster der lieben Frau Melcher ausgeliehen, ein schwarzes Monster mit Namen Verminator. Der Terminator der Lüftung erleichtert die Situation im Inneren, auf dem Küchenbalkon steht ein Eimer Wasser zur Kühlung der Füße. Es ist sogar zu heiß, um ins Schwimmbad zu gehen. Auch aus klimatischen Gründen wird es also höchste Zeit, ein Feriendomizil zu finden. Selbst wenn es dort brütend heiß sein würde, könnten wir sagen, im Urlaub gehöre das dazu.
Die Bretagne lockt aus Karlsruher Sicht mit Atlantik-Wind, Atlantik und bretonischem Ambiente. Aber irgendwie findet sich nicht das Richtige: zu teuer, zu weit weg, zu groß, zu klein, kein WLAN bei den meisten, das geht gar nicht mehr. Bei der Verfolgung der Wetterentwicklung zeichnet sich ab, dass die Bretagne dieses Jahr keinen schönen Sommer zu bieten hat, mehr als 22 Grad Höchstwert sind nicht in Sicht. Momentan zwar verlockend, aber 13 Grad nächtens, das ist L. dann doch zu herbstlich. Also sucht U. in der Provence und, als hätte es so sein sollen, hat sie nach zwei Klicks das Richtige gefunden, ein Paradies südlich von Avignon. Die fünfzehn Zettel mit vergleichenden Notizen zu fünfzehn bretonischen Domizilen werden erleichtert und von provenzalischer Vorfreude beflügelt ins Altpapier geworfen.
Freitag, 17. August 2018
Dijon ist sehr wahrscheinlich eine Extra-Reise wert. Wir allerdings übernachten dort nur. Und das vor allem deshalb, weil es auf halbem Weg nach Saint-Andiol in der Nähe von Avignon gelegen ist. Was uns gelegen kam. Warum der zehnjährige Mozart dort übernachtet hat, weiß man auch: weil er mit son cher papa auf Konzertreise und Dijon eine aufstrebende Stadt mit raffiniert-extravagantem höfischem Leben war.
Das „Hotel“, das U. für uns gebucht hat (es nennt sich Appart’City) erweist sich als kleine Siedlung vor den nicht mehr vorhandenen Toren der Stadt. Bestehend aus zehn quadratischen Gebäuden mit einem Erd- und einem Obergeschoss und jeweils einem Dutzend Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe. In einem elften Haus sind die Rezeption und der Frühstücksraum (Frühstück ist nicht obligatorisch) untergebracht. Zwischen den Häusern gibt es Parkplätze. Das schmale Tor ist zwischen Null und Sieben Uhr geschlossen und um die ganze Anlage hat man einen Zaun gezogen.
L. fragt die Rezeptionistin, deren Englisch zum Glück noch holpriger ist als sein eigenes, ob sie einen Plan von der Innenstadt habe, und ob man dorthin, in die Innenstadt, zu Fuß gehen könne. Da es „too far to walk“ ist, nehmen wir das Auto. Am Rande der älteren Altstadt hat die Vorsehung einen Parkplatz für uns freigehalten und nach zwei, drei Fehlversuchen, gelingt es uns sogar, am zuständigen Parkscheinautomaten einen Parkschein zu ertasten (oder zu ertastaturen).
Die Altstadt von Dijon, das ist, von einigen noch älteren Fachwerkhäusern abgesehen (das windschiefe Gerümpel erinnerte uns an die Übernachtung in Troyes im letzten Jahr auf der Rückfahrt von der Gironde), vor allem 18. Jahrhundert. Sehr schön. Sehr schön auch der von Millionen von Füßen glattpolierte helle Steinboden der Straßen.
Als die Dichte der kleinen Restaurants, die aus einigen auf die Straße gestellten Tischen nebst im Haus befindlicher Küche bestehen, zunimmt, geben wir unseren Widerstand gegen den Drang, uns niederzulassen und zwei Spritz und etwas zum Essen zu bestellen, auf. Und lassen uns nieder und bestellen zwei Spritz und etwas zum Essen. U. bestellt einen Rockford-Salat, L. bestellt das, was hier beinahe alle essen: Pizza. Der Salat sieht hübsch aus, liegt aber leider, abgesehen von ein paar dekorativen Essigspritzern auf dem Tellerrand, völlig secco auf dem Tellero. U. fragt bescheiden nach ein bisschen Öl („Pizzaöl oder Salatöl?“ – „Salatöl“). Der zierliche schwule Kellner bringt das Öl in einem putzigen kleinen Porzellankännchen. Der Pizza-Teig ist hervorragend, der Belag viel zu üppig und zu feucht. Der Spritz ist nicht spritzig genug. U.s Befürchtung, dass der Aperol nicht zum Essen passt, bewahrheitet sich. Ein französisches Paar am Nachbartisch macht es richtig: Sie trinken in Ruhe zuerst den herrlich orangefarbenen Aperitif und bestellen dann zur Pizza eine Flasche Rotwein. Unsere Nachbarin lacht immer ungenierter, nach dem Essen ist die Rotweinflasche leer. Wir genießen, wenn nicht das Bestellte, so doch das Ambiente und die Situation als solche.
Auf dem Rückweg zum Auto (es ist mittlerweile fast dunkel geworden), freuen wir uns am bunten Spiel der Wasserspiele und am heiteren Hin-und-Her der Passanten und Restaurant-Besucher zwischen den, wir sagten es schon, prachtvollen Häusern aus mehr oder weniger unlängst vergangenen Zeiten.
Samstag, 18. August 2018

Ob ein Tag im Auto ein unerträglich langer oder nur ein normal langer gewesen sein wird, entscheidet sich manchmal erst auf den letzten 150 Kilometern. Vor Valence wird der Verkehr immer dichter, so dass wir uns auf L.s Drängen entschließen, die Autobahn zu verlassen, um auf die parallel verlaufende Nationalstraße auszuweichen. Auf diese gelangten wir aber nur auf dem Umweg über einen Stau vom Typus Jetzt-geht-gar-nichts-mehr-und-kein-Ende-in-Sicht. Als dann doch irgendwann (gefühlt: nach Tagen) ein Schild auftauchte, welches eine Abfahrt von der zweispurigen Schnellstraße in tausendzweihundert Metern Entfernung ankündigte, wurde L. zum Verkehrsrowdy und fuhr auf der ziemlich schmalen Standspur an dem ganzen Elend aus Blech, Schweiß und Abgasen so zügig wie es eben ging vorbei, wobei er sich nicht nur den Zorn der (geradeaus weiterfahren wollenden) in ihr Schicksal ergebenen Mehrheit, sondern auch den seiner Ehefrau zuzog. Aber einmal begonnen, wollte und konnte L. seinen waghalsigen Alleingang (der mittlerweile kein Alleingang mehr war, denn einige andere hatten sich sein Fehlverhalten zu eigen gemacht und folgten ihm mit finster entschlossener Mine) nicht abbrechen. U. beschwörend: „Das kannst Du nicht machen, vor allen Dingen nicht so schnell!!“ Sie hält sich die Hand vor Augen, um nicht die nur wenigen Zentimeter zwischen Betonbegrenzung auf der rechten und den Autos auf der linken Seite sehen zu müssen. „L., reiß Dich zusammen!!“ L. gänzlich ungerührt: „Kann ich nicht und will ich nicht.“ Entweder er kam damit durch oder er landete im Gefängnis.
Nach einer bangen Minute, „die uns wie eine Ewigkeit vorkam“ (wie man wohl sagt), erreichten wir die Ausfahrt und fuhren befreit und erleichtert davon. Nun noch auf die N7 zu gelangen, war gegen das, was wir in der letzten Stunde durchgemacht hatten (um vom krönenden Abschluss nicht zu reden), ein Kinderspiel und das reinste Vergnügen. Aber auch auf der Nationalstraße wurde der Verkehr nach und nach immer zähflüssiger und es kam zu ersten Stockungen. Nach bewährtem Muster (aber ohne Regelverstoß), verdrückten wir uns bei passender Gelegenheit auf die nächst kleinere Parallelstraße, die auf der rechten Seite der Rhone von village zu village führte. Keine der hübschen Ortschaften und imponierenden Atomstromproduktionsstätten auslassend, kamen wir mit Durchschnittstempo 60 (oder so) zügig voran. Hauptsache fahren können und nicht im Stau stehen müssen.


To make a long story as short as possible (wie der Franzose sagt): Irgendwann nach 19 Uhr (und nach fünfhundert Kilometern in achteinhalb Stunden) erreichen wir Saint-Andiol und nahe dabei die kleine Ferienanlage von Herrn A., der uns nach einem kurzen Gespräch mit U. das elektrisch betriebene große Tor zu seinem Ferien-Paradies öffnet. Herr A., der U. schon am Telefon bezirzt hatte, entpuppt sich als der sympathische und gutaussehende Endvierziger, den man sich als Betreiber eines solchen Etablissements vorstellt. Zu allem Überfluss ist er auch noch eine rheinisch Frohnatur, der man nichts abschlagen kann. Auch nicht das „Angebot“, sich gegenseitig zu duzen, weil: „mir ist das am liebsten so“. Wie es uns am liebsten ist, wurden wir von Herrn A., der mit Vornamen B. (wie Bernd) heißt, vorsichtshalber gar nicht erst gefragt.
Sonntag, 19. August 2018
Ungefähr um die Zeit, zu der man früher aus der Kirche kam, fuhren wir zum Einkaufen nach Saint-Andiol. Von unserem Domizil aus wäre es zwar nicht too far to walk gewesen, aber zu trostlos. Und knapp zwei Kilometer ohne Trost? Wer nimmt das auf sich, wenn es nicht nicht anders geht. Es ging aber anders und auch der Golf war erleichtert darüber, dass wir ihn nicht alleine neben den überdimensionalen Spielzeugautos der anderen Feriengäste stehen ließen. Apropos Autos: Wie hatten die Engländer (von denen unten noch die Rede sein wird) es bloß geschafft, sich zu viert mit Doodle-Dog (von dem unten gleichfalls noch die Rede sein wird) und Gepäck (von dem unten nicht noch einmal die Rede sein wird) in diesen aufgeplusterten Kleinwagen zu zwängen und darin von Merry Old England über den Kontinent bis fast ans Mittelmeer zu fahren? Sind diese XXL-Kinder-Autos innen doch wesentlich geräumiger, als es von außen den Anschein hat? Wo war der Trick? Wo war der Anhänger oder doch wenigstens der externe Speicherplatz auf dem Dach oder sonstwo?
Montag, 20. August 2018
Wir wohnen hier in einem provenzalischen Paradies, man kann es nicht anders nennen. Ein Gehöft, ehemals von Mönchen bewohnt, liegt entlang einer Sackstraße genau in Ost-West-Ausrichtung (um den aus Norden wehenden Mistral zu brechen). In oinere Roi liegen das Haupthaus (von Bernd mit portugiesischer Ehefrau und vierjähriger Tochter bewohnt), ein längerer niedriger Bau mit drei Appartements (bewohnt von der englischen Familie samt schokofarbenem Goldendoodle, dann einem französischen Paar, dann einem deutschen Paar) und einem ehemaligen Stall, bewohnt von uns. Au wei, denkt U. zunächst, was wird L. zu den vielen Leuten sagen? Und zu dem rheinländisch kontaktfreudigen Bernd?
Immerhin, wir sind die ersten bzw. letzten in der Reihe und residieren etwas nach vorne versetzt, keiner guckt uns auf den Baguette-Teller und obendrein haben wir um die Ecke einen Platz für uns mit Hollywoodschaukel. An der Gartenseite des Hauses steht auf dem Kiesplatz eine große alte Platane, dazu gibt es überall verteilt Oleander- und Palmenkübel, Töpfe mit diesem und Töpfe mit jenem, Esstische – alles sehr gepflegt und sehr provenzalisch. Dahinter, nach einer mistralbrechenden Hecke erstreckt sich ein riesiges Rasenareal, begrenzt und beschattet von einer Pappelreihe, auch in Ost-West-Linie, welche dann den von unserem Grundstück wehenden Mistral für das dahinterliegende Obstbaumfeld bricht. Es gab entlang der Straße in Fortsetzung des Hauses noch eine weitere mistralbrechende Reihe aus 13 sehr großen Zypressen, von denen nur noch eine übrig ist. Durch Funkenflug aus Nachbars Garten standen 12 Zypressen in Flammen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, hatte aber vergessen, den Wassertank zu füllen („das ist uns noch nie passiert!“), weswegen die zwei Schläuche recht nutzlos waren. Die 12 waren dahin, die eine (die erste in der Reihe) überlebte, warum, das bleibt uns gegenwärtig noch schleierhaft. Nun kann der Mistral ungebrochen auf den Parkplatz pusten, die eventuell umherwirbelnden Automobile werden dann vor der Obstplantage von der dazu bereit stehenden Pappelreihe aufgefangen.
Dieser Tag war auch der Tag, an dem der neue Rooter kam. Der alte war vor einer Woche oder so einem schweren Gewitter zum Opfer gefallen. „Plötzlich roch es verbrannt“, meinte Bernd. Das heißt, am Nachmittag waren wir damit beschäftigt, E-Mails zu löschen und Fotos vom Handy erst zu Google-Fotos hoch und dann von dort auf den Laptop runterzuladen. Und so weiter – was man halt so zu tun hat, wenn man zwei ganze Tage lang ohne Internet auskommen musste. Vormittags testeten wir die gusseisernen Liegen, den Baumschatten und den kleinen runden Pool, wenn er gerade mal frei war.
Die Engländer sind den ganzen Tag am Pool. L. meint, ihr Englisch sei Upperclass, Prinz William spreche auch so. (Peter Sloterdijk in Neue Zeilen und Tage: „Das britische Englisch klingt inzwischen so, als wollte ein ganzes Volk die Royals parodieren.“) Aha, denkt U., da werde ich mal fleißig zuhören. Sie hört nicht nur, sondern wagt sich etwas später sogar in ein Gespräch, nachdem Mary-Anne (oder so) höflich fragte, ob ihre Jungs zu laut seien. Waren sie natürlich, aber so etwas sagt man natürlich nicht. Sie und ihr griechischstämmiger Ehemann Sirus liegen tatsächlich bei 32 Grad im Schatten ständig in der Sonne (nach unserem Thermometer dann 43 Grad). U. meint, das würde sie nicht aushalten, worauf Mary-Anne sagt, U. würde ja auch nicht in England leben. Sie hätten höchstens zwanzig, allerhöchstens dreißig Tage Sonne im Jahr. Das Wetter sei schrecklich, ständig Grau und Regen, es sei kaum zum Aushalten. (Jetzt wissen wir also, warum die vielen krebsroten Engländer an den Stränden rund um das Mittelmeer trotz Verbrennungen fünften Grades weiter in der Sonne liegen, sie tanken Sonne für ein Jahr).
Endlich fuhren wir einkaufen und sahen uns die burgähnliche Kirche von Saint-Andiol aus dem 13. Jahrhundert an. Von außen, da sie verschlossen war, wie es sich für eine Burg-Kirche oder Kirchen-Burg wohl gehört.
Dienstag, 21. August
Zwei Tage lang darf man ankommen, am dritten Tag muss etwas unternommen werden. Zum Schauplatz unserer ersten unternehmerischen Aktivitäten hatten wir Saint-Rémy bestimmt. Van Gogh verbrachte dort, schon gegen Ende seines kurzen Lebens, ein paar Monate in einem Kloster, das zugleich eine Art Irrenanstalt war. Seine Therapie bestand darin, dass er malte. Eigentlich hätte er dafür nicht ins Irren-Kloster gehen müssen, aber wer weiß, wozu es gut war.
Anstatt das Van-Gogh-Kloster zu besichtigen, besorgten wir uns Druckerzeugnisse (Zeitung, Ansichtskarten, Straßenkarte) und nahmen einen Imbiss in einem Restaurant ein, das Café und Crêperie zugleich war. Zuvor jedoch kaufte U. sich einen neuen Hut. Auf ihre Frage, welche Farbe er am besten finde, entschied sich L. ohne mit der Wimper zu zucken für ein kräftig leuchtendes Gelb, das schon beinahe ein Orange war. Und blieb stur bei seiner Entscheidung, obwohl U. mehrmals nachfragte, ob nicht doch dieses Grün oder jenes Rosa ihr besser zu Gesicht und so weiter stünden. Männer sind unmöglich.

Unmöglich war es auch, wie L. den Golf gleich zu Beginn der Rückfahrt durch den Verkehr steuerte als wäre er hier zuhause. Und selbst wenn er es tatsächlich gewesen wäre, wäre diese Fahrweise, gewissermaßen unter Einsatz der Ellbogen, völlig inakzeptabel gewesen. Da sich L. auf Diskussionen über seinen Fahrstil grundsätzlich nicht einlässt, wechselte er auf den Beifahrerinnensitz, von wo aus er U. mit sicherem Instinkt für die richtige Richtung und mit Hilfe des ein oder anderen Blicks in die gerade erst erworbene Straßenkarte nach Saint-Andiol zurück dirigierte.
Bleibt nachzutragen, dass wir am Anfang unseres Aufenthalts in Saint-Rémy, wenn man so will, das Gegenteil eines Bekehrungserlebnisses hatten. Sozusagen routinemäßig betraten wir, gleich nachdem wir das Auto geparkt hatten, eine große Kirche, eine obskure Mischung aus ziemlich alt und schlechtem Klassizismus. Das Innere wirkte wie eine bildliche Metapher (falls es so etwas gibt) für den Untergang des christlichen Abendlandes im allgemeinen und den Niedergang des europäischen Christentums im besonderen. Da dieser Reisebericht bebildert ist, verharren wir an dieser Stelle in sprachlosem Entsetzen und verweisen auf den fotografischen Teil. Mögen es die französischen Christen gerne gruselig? Der Verdacht könnte einem kommen, denn es war nicht das erste Mal, dass wir in Frankreich (dem Land, in dem Gott wie in Frankreich lebt) auszogen, uns eine Kirche von innen anzusehen, um dann ästhetisch traumatisiert wieder heimzuziehen.

Mittwoch, 22. August 2018
Wir taten das, was man so tut, wenn man nichts tut. Nicht einmal zum Einkaufen verließen wir Haus und Hof, da Wein und Brot noch in ausreichender Menge vorhanden waren.
So nach und nach erkennen wir die Routinen der anderen Paradiesbewohner. Das französische Pärchen (sie immer elegant, schlank, jung und hübsch – eine Französin, wie sie im Buche steht) verlässt das Anwesen am Vormittag, spätestens um halb elf und kommt frühestens um halb elf des Abends zurück, eigentlich hätten die beiden auch in irgendeinem Aparthotel an der Peripherie von Avignon übernachten können. Das deutsche Paar schnallt um halb zehn die Räder hinter den weißen SUV aus DH und kommt abends mit ordentlichem Sonnenbrand zurück. Sie klingen norddeutsch und haben ein zwar freundliches, aber irgendwie pädagogisches Wesen. U. mutmaßt, sie können nur Lehrer oder evangelische Pfarrer sein. Von den Engländern erscheint zu unserer Frühstückszeit (so um halb elf) er oder sie noch sehr verschlafen und quasi durchsichtig im Nachtgewand mit Ralph an der Leine und Tütchen in der Hand, damit der sein Morgengeschäft verrichten kann. Nach Geschäftsabschluss verschwindet der Schokodoodle samt Begleitung wieder. Etwa gegen halb zwölf, zur besten Mittagshitzenzeit, ziehen Sirus, Mary-Anne, Pavlos (Sohn 1, 21 Jahre, wohl aus der ersten Ehe von Sirus), Anthony (Sohn 2, 12 Jahre) und Schoko-Ralph zum Pool, um dort bis zum späteren Nachmittag in der Sonne zu braten. U. versteht das Sonnenbedürfnis der wolken- und regengeplagten Engländer bis zu einem gewissen Grad, aber angesichts der nach wie vor über dreißig Grad im Schatten versteht sie es doch nicht. Zumal sie gar nicht brauner werden, selbst der griechischstämmige, in England aufgewachsene Sirus nicht, der übrigens sehr gentlemanlike und mit hinreißendem mediterranen Lächeln U. jeden Vormittag begrüßt: „Hallo Ute, how are you?“ U. gefällt das. U. legt sich höchsten ab 15 Uhr für ein oder zwei Stunden in die Sonne, eher noch später und zwar, um braun zu werden. Ansonsten bevorzugt sie den Halb- oder Ganzschatten. Aber fünf Stunden mit Sonnenschutzfaktor fünfzig in der Sonne braten, um nur ganz wenig nachzudunkeln, nein, das verstehen wir nicht wirklich. Am späteren Nachmittag also verschwindet die englische Belegschaft für zwei Stunden im Haus, um zu ruhen. Danach brechen sie auf, um Abendessen zu gehen.
Donnerstag, 23. August 2018
Um zwölf Uhr Aufbruch nach Saint-Rémy, wir wollten uns Glanum ansehen und vielleicht noch das Irren-Kloster, in das man van Gogh 1889/90 einquartiert hat. Oder hat er sich selbst eingewiesen? Die Quellenlage scheint dürftig zu sein.
In Glanum stehen nur noch ein paar wenige größere Gebäudeteile und ein paar Säulen senkrecht. Ansonsten sieht man nur die üblichen horizontal sich erstreckenden Mauerrechtecke, dort wo einmal die Häuser standen. Zwei Ausnahmen sind ein gut erhaltender Triumphbogen und ein Turm mit quadratischem Grundriss und großen Reliefs mit Kampf-Szenen auf allen vier Seiten. Die sollten den Galliern wohl vor Augen führen, was ihnen blühte, wenn sie sich mit den Römern anlegten. Wir gingen für je acht Euro einmal von unten nach oben der Länge nach durch und auf einem hochgelegenen Weg mit schönem Blick über die Trümmer und weit in die Ebene hinein wieder zurück. Es war sehr heiß, windstill (ohne ihren neuen Hut hätte U. den Besuch dieses Glutfeldes niemals ertragen) und nicht viel los. Danach in einer Open-Air-Bar unter Bäumen für relativ wenig Geld bei freundlicher Bedienung: Abkühlung, Wasser, Apfelkuchen mit Schlagsahne und Kaffee.
Das Van-Gogh-Kloster wäre gleich daneben gewesen, das stellten wir aber erst fest, als wir schon wieder durch Saint-Rémy fuhren und auf der Karte danach suchten. Wir verzichteten darauf, noch einmal dorthin zurück zu fahren (gerade war es im Auto dank Klimaanlage wieder erträglich geworden) und fuhren dafür zurück nach Saint-Andiol, wo wir im Supermarkt einkauften.
Es war und ist der windstillste, heißeste und schwülste Tag bisher. Wir nehmen unsere Handtücher und Bücher, um uns im Schatten der Pappelreihe niederzulassen. Eigentlich der angenehmste Platz auf dem Areal, im Häuschen hat es mittlerweile auch 30 Grad. Selbstverständlich folgt solch einem „eigentlich“ ein „aber“. Das Aber besteht zum ersten in der ungebremsten Spielfreude von Ralphi, der sich unbeeindruckt von „Raaalph, come here, Raaaaalphi, no!“ diverse Gegenstände von der Taucherbrille bis zum Flipflop schnappt, damit davonrennt und freudig darauf wartet, dass man ihm hinterherrennt. Mary-Anne tut ihm immer wieder die Freude, natürlich ist er schneller und gibt keines seiner diversen Beutestücke her. Doch alle kann er nicht gleichzeitig bewachen und Mary-Anne versteckt alles, was sie finden kann, unter ihrer Liegenauflage. Schließlich ist auch die Taucherbrille eingesammelt, Ralphie läuft suchend umher und entdeckt U.s neuen Strohhut neben ihrer Liege. Schon reißt er sein Maul auf, doch U. brüllt ein derart vehementes, unmissverständliches „NO!!“, dass ihm der Unterkiefer nicht runter, sondern wieder hochklappt und er guckt erstaunt. Diese Tonlage scheint ihm fremd zu sein. Besorgt kommen Sirus und Mary-Anne angehastet und greifen ihren Sprössling am Halsband. U. könne Ralph gerne einen Klaps geben, wenn er nervt, sagt Sirus entschuldigend und besorgt. U. findet insgeheim, ihr „NO“ war durchaus erfolgreich, im Gegensatz zu dem oft zu hörenden „no“ der Hundebesitzer, ein Klaps würde künftig wahrscheinlich nicht nötig sein.
Das zweite Aber sind unendlich viele Mücken, die sich aus dem Unterholz der Pappelallee auf alle Menschen stürzen – je näher der Hecke, desto besser. Merkwürdigerweise hinterlassen diese Attacken (bei uns) keine nachhaltig juckenden Stiche, nervig ist es trotzdem. Nach einer erfrischenden Runde im Pool nimmt U. Handtuch, Buch und Hut, es reicht. Mary-Anne fragt an, ob sie auch von so vielen mosquitos geplagt werde. Sie könne nachts nicht schlafen, weil sie so zerstochen sei und alles fürchterlich jucke. Sie sieht tatsächlich schlimm aus: im Gesicht, an den Beinen, Armen, einfach überall hat sie dicke rote Stiche, kein Antimückenmittel helfe. Beeindruckt fragt U., was „Stich“ auf englisch heißt und deutet auf einen der Hubbel. „Bumps“, sagt Mary-Anne, also mit a gesprochen. L. fragt „bombs“? Müssen wir mal nachsehen. Jedenfalls, U. hätte niemandem sagen dürfen, die Mückenstiche hätten bei ihr keine Folgen, am Abend hat sie auch bumps und sie jucken.
Freitag, 24. August
Von unserem Ferienhofgutsbesitzer hatten wir den Hinweis bekommen, dass heute in Eygalières Markt sei. War das einer jener Vorschläge, zu denen man nicht nein sagen kann? Wir jedenfalls zögerten nur kurz, nahmen dann den Impuls ebenso willig wie dankbar auf und fuhren in den übernächsten südlich gelegenen Ort. Und tatsächlich war der Markt die kleine Reise wert.
Es gab drei Markt-Arme, die über das Dorfzentrum miteinander verbunden waren. Das Angebot war das übliche: etwas für in den Leib, etwas für an den Leib und Sonstiges. Unter Sonstiges erwarb L. ein hoffentlich handgeschmiedetes Messer und zwei wahrscheinlich handgetöpferte Schälchen. U. kaufte Wein, der allerdings (wie wir später bemerkten) nicht aus der Region stammte, jedenfalls nicht aus der hiesigen, sondern aus der um Marseilles (auch schmeckte er zuhause längst nicht mehr so überzeugend wie beim Probieren vor Ort).
Das also war der Markt in Eygalières. (Es gab im Umkreis von zehn Kilometern drei Ortschaften, die mit „Ey“ anfingen, wir konnten sie namentlich nie auseinanderhalten.) Und als wäre das nicht schon genug Neuheit und Abenteuer gewesen, probierten wir auf der Rückfahrt in weitem Bogen auch noch einen (für uns) neuen Supermarkt in Châteaurenard aus – und waren durchaus angetan, und das gleich zwiefach (double, wie wir Altfranzosen sagen): einmal beim Besuch desselben und das andere Mal, als wir am Abend den dort gekauften Fisch aßen. Für schrecklich wenig Geld ein erschreckend guter Fisch. „Erschreckend“ deshalb, weil man so einen Fisch in Karlsruhe eigentlich nirgends kaufen kann. Was für einer es war? Vergessen. Zwei relativ kleine, sehr helle Fischfilets sind es gewesen. Länger als vierzig Zentimeter wird der ganze Kerl kaum gewesen sein.
Samstag, 25. August 2018
Den nervigen Goldendoodle sind wir wieder los, seufzten wir erleichtert, als am späten Vormittag die gemischteuropäischen Briten mit dem unfreiwillig parodistischen Zungenschlag (siehe oben) die Heimfahrt Richtung Insel antraten. L. war vom angeblich griechischstämmigen Sirus (wenn Griechen sagen, sie seien Griechen, ist bekanntlich Misstrauen geboten, auch wenn sie behaupten, nicht aus Kreta zu stammen) übrigens keineswegs in gleicher Weise begeistert wie U., die Sirus bereitwillig bis freudig (siehe oben) als Trainings-Objekt für seine täglichen Charme-Übungen zur Verfügung stand. Der anglizierte Grieche oder Kreter war ihm von Anfang an gegen den Strich gegangen. Wenn einer den ganzen ersten Ferientag lang vom Pool aus mit laut und wohltönender Hörbuchvorleserstimme seinen Söhnen Gott, Frankreich und die Welt erklärt, will er sich und seine Umgebung nicht nur in eitler Weise beeindrucken, sondern vor allem auch über irgendetwas hinwegtäuschen. Was hatte der Mann zu verbergen? Eine zerrüttete Ehe (Mary-Anne wirkte auf L. irgendwie drogenabhängig)? Schulden aufgrund von Fehlspekulationen? Den eklatanten Missgriff beim Kauf seines Autos? Impotenz? Oder schlimmer noch: Haarausfall? L. wusste es nicht und wollte es auch nicht wissen. Sirus jedenfalls wendete, sooft er an L. mit zusammengekniffenem Mund vorbeiging, den Kopf zur Seite und gab damit zu erkennen, dass ihm klar war: man hatte ihn durchschaut. Erschwerend hinzu kam natürlich, dass L. dem gefälschten Briten nicht seine Aufwartung gemacht und damit keine Gelegenheit gegeben hatte, sich als der joviale Charmeur zu präsentieren, der er nicht war. So einer kann so etwas nicht verzeihen.
Den nervigen Goldendoodle sind wir nun endlich wieder los, hatten wir also eben erst (siehe oben) geseufzt, als eine schwarze Limousine knirschend (der Kies) aufs Gelände rollte. Es entstiegen ihr mit und ohne fremde Hilfe vier Schwarzwälder, was wir aber erst am nächsten Tag erfuhren. Denn zunächst hielten wir den Vater, die Mutter und die zwei (kleinen) Kinder, Gott steh uns bei, aufgrund des Autokennzeichens für Karlsruher. Gott steh uns bei, soll heißen: zwei Gören (Sebastian im Quengel- und Helena im Herumwackel-Alter) und dann auch noch von bei uns um die Ecke. Das kann ja heiter werden, dachten wir, aber es wurde immer wolkiger. Denn das Wetter hatte umgeschlagen und ein mittelstark wehender Nordwest, der die Pappeln zum Rauschen brachte, wehte nicht nur die Blätter von der Platane, sondern auch kühle Luft und eine Ahnung von Herbst heran.
Ja und dann waren da auch noch eine dreiköpfige Familie aus dem Bayerischen und ein Udo aus dem Saarland neu dazu gekommen. Doch das für den Sonntag anberaumte gemeinsame Grillen (wenn ihm die Wortfolge „Grillen mit Freunden“ begegnet, bekommt L. einen Anfall von Soziophobie) wird noch Gelegenheit geben, mehr, noch mehr und noch viel mehr über sie zu berichten.
Spät, nachdem die Sonne erfreulicherweise wieder hervorgekommen war, fuhren wir auf U.s löbliches Drängen hin in den gestern erst besuchten Marktflecken Eygalières und stiegen auf den kleinen Hausberg zur Ruine einer alten Kapelle hinauf. Wir freuten uns über den schönen Rundblick und das wunderbare Abendlicht. In weiter Ferne ganz nah lag in seiner in sich ruhenden Erhabenheit der Mont Ventoux.
Am Abend frischt der Wind auf. Die Pappeln rauschen, weiter weg braust es in einer anderen Tonlage, U. muss an Peter Handkes Beschreibung der verschiedenen Baumgeräusche bei Wind denken. Kissen werden von den Stühlen gefegt, der Plastik-Killer-Wal vom Pool landet im Gebüsch, die große Platane wirft trockene Blätter in Massen ab. Das muss der Mistral sein, jetzt können Pappeln, Zypressen und Hecken zeigen, was sie (als Windschutz) drauf haben. U. sammelt schnell die Badetücher ein. Beim Abendessen zerrt unser Sonnenschirm bedenklich an seiner Verankerung im Betonsockel.
Sonntag, 26. August 2018
Wir hatten gestern vergessen, den Sonnenschirm rechtzeitig zusammenzuklappen, spät abends gab es vor dem Fenster dann einen ziemlichen Krach. Als wir nach draußen sahen, war der Schirm weg. Nur mit Hilfe der Handytaschenlampe fanden wir ihn hundert Meter weiter am Fuß der Platane. Wir besahen den Schaden: ein Arm des Gestänges war gebrochen. Mit Hilfe von Pflasterband und einer hölzernen Salatgabel reparierte L. die Bruchstelle. Als wir dem Hausherrn das Missgeschick gestehen und auf die reparierte Stelle deuten, ist er schwer beeindruckt: „Das können sonst nur Provencalen und Kubaner“, meint er anerkennend.

Tag der gesellschaftlichen Termine. L.s Freund Markus verbringt nicht weit von uns in Villeneuve d‘ Avignon mit Gattin, Tochter und deren Freundin ebenfalls 14 Tage im Provenzalischen. Er schickt L. die Adresse und eine Google-Maps-Karte, auf der die Reisedauer mit 4 Stunden angegeben ist, wie sich herausstellt: zu Fuß. Wir werden um 15 Uhr zum Kaffee erwartet, L. hatte angekündigt, die Beilagen zum Kaffee mitzubringen.
Schon die Aussicht, zwei Termine an einem Tag bewältigen zu müssen, hatte U. schlecht schlafen lassen, sie wachte mehrmals schweißgebadet auf und konnte nur schlecht wieder einschlafen. Gerade war sie endlich eingeschlafen, da weckt sie L. um kurz nach zehn. Völlig gerädert sitzt sie am Frühstückstisch und versucht vergeblich, in den Aktions-Modus zu kommen. Wenig später sitzen wir im Auto (U.s Kreislauf liegt noch im Bett, aber der Bäcker macht bald zu), um im Nachbardorf bei dem von Bernd gepriesenen Patissier Kuchen zu kaufen. Bei Google-Maps hat L. die Route schon virtuell Probe gefahren und findet mühelos die Patisserie. In der Kühltheke liegen eine bienenstichartige Torte mit bunten Zuckerobjekten obendrauf (27,90 EUR), eine Schokotorte (34,95 EUR), ein Zwetschgenkuchen (19,50 EUR) und diverse kleine, bunte Stückchen (je 2,50 bis 3,90 EUR). L. wäre für den Bienenstich, der ist U. aber zu zuckrig. U. wäre für die Schokotorte, die ist aber zu teuer (findet sie). Bleiben der Zwetschgenkuchen und die kleinen Bunten. Wäre sie wach, würde sie für sechs Leute ein buntes Arrangement zusammenstellen, sie ist aber nicht wach. Also kauft L. kurzerhand den Zwetschgenkuchen, eigentlich eine badische Spezialität. U. hat kein gutes Gefühl. Doch die leckeren tarte aux pommes, die man hier überall kaufen kann, gibt es nicht, wahrscheinlich schon ausverkauft. Im Supermarkt holen wir dann noch unser Grillgut für den Abend.
Wieder daheim, legt sich U. in der Hoffnung, den nicht gehabten Schlaf nachholen zu können, noch einmal hin, L. setzt sich mit der Straßenkarte an den Computer. Eineinhalb Stunden bereitet er sich analog und digital auf die Tour vor: Von oben gesehen ist klar, wie man bis nach Villeneuve gelangt, für die kniffligen Details nach Abfahrt von der Schnellstraße nach Nimes macht er sich Notizen in seinem kleinen roten Büchlein.
Nach gefühlten fünfundvierzig Kreiseln auf der Landstraße und einer baustellengefüllten Durchfahrung Avignons (ja, die können das auch) erreichen wir gegen 15:15 Uhr besagte Schnellstraße nach Nimes und kurz darauf die Abfahrt. U. biegt auf L.s Geheiß ab, wir sind nun in einem Industriegebiet. Von Kreisel zu Kreisel kommt L. die Sache spanischer vor, nichts stimmt mit dem überein, was in seinem Büchlein steht. Praktisch und lösungsorientiert denkend schlägt U. vor, Madame Google einzuschalten, doch ihr L. hat nicht derart lange Karte und Maps studiert, um bei der ersten Hürde die Flinte ins Gebüsch zu werfen oder wie man sagt. Wir fahren zurück auf die Schnellstraße, nehmen dann die nächste Ausfahrt und landen wieder in demselben Industriegebiet. Dann fahren wir abermals zurück auf die Schnellstraße und probieren die zweitnächste Ausfahrt. Nun sind wir endgültig in der provenzalischen Wüste angelangt, von einer menschlichen Siedlung ist nichts zu sehen. U. fährt beherzt an den Straßenrand. Beim Springreiten, wenn das Pferd zum dritten Mal den Sprung verweigert und der Reiter mit abgenommener Kappe den Kopf geneigt hat, tönt es vom Richterturm: „Der Reiter gibt auf“. Hier gibt die Fahrerin auf und überlässt Madame Google das Kommando. Sieben Minuten später sind wir am Ziel angekommen.
Es gibt Kaffee, Tee, tarte aux pommes vom Vortag und Pflaumenkuchen von heute. Die vergleichende Bewertung fällt unterschiedlich aus: Die Gastgeber finden unseren Zwetschgenkuchen besser, wir finden den Apfelkuchen besser.
Auf der Rückfahrt nehmen wir eine andere Strecke, fahren bei Avignon über die Rhone und haben einen herrlichen Blick auf die Stadtmauern samt Papstpalast. Da müssen wir während unseres diesjährigen Aufenthaltes doch noch hin, beschließen wir. Zum einen müssen wir in unserem Stammcafé einen Kaffee trinken, zum anderen hat Claudia gesagt, in dem kleinen Barockschlösschen neben dem Papstpalast seien Renaissance-Italiener ausgestellt, wunderschön. Überhaupt haben Markus und Claudia schon einige Ausstellungen besucht, Tochter und Freundin müssen ja ein bisschen Kulturprogramm haben. Wir können da nicht mithalten, bisher haben wir um die Museen einen großen Bogen gemacht und nur die alten Römertrümmer angesehen.
Bis wir aus Avignon draußen sind, dauert es entlang einer kilometerlangen Baustelle ungefähr zwanzig Kreisel, die alle vor dem Kreisel und in dem Kreisel mit einer roten Ampel versehen sind. Nanu, denken wir, Kreisel mit Ampel können doch nur die Karlsruher. Nein, die Avignonesen sind uns da haushoch, turmhoch überlegen. Der Grund der Baustelle ist die Gleisverlegung einer neuen Straßenbahntrasse, oberirdisch. Wir fühlen uns fast wie zu Hause.
Nach gut einer dauergekreiselten Stunde fahren wir auf den Hof und sehen die Belegschaft schon am Grill stehen. U. ist nach dem dreistündigen, wunderschönen Kaffeplausch und der Höllenfahrt nicht in der Lage, nahtlos weiterzukommunizieren und bedingt sich bei ihrem L. eine Stunde Ruhe aus. L. aber hat Hunger und strebt zur Hofgesellschaft. U. kann es kaum glauben, ihr sozial eher reservierter Gatte geht übergangslos von der Kaffee- zur Grillrunde über?! Verwirrt raucht sie um die Ecke bei der Hollywoodschaukel ein, zwei Zigaretten, sieht ihren Mann danach tatsächlich plaudernd und lächelnd (tatsächlich!) inmitten der Runde und versinkt für ein Stündchen in die Kissen.
Montag, 27. August 2018
Wir verdösten den Tag auf der Liegewiese. Gegen Abend fuhr L. alleine zum Einkaufen. Das heißt, er hatte weder U. zum Lesen der Karte noch Miss Google zum Vorsagen der richtigen Lösung beim sich Kreuzung für Kreuzung wiederholenden Abbiegerätsel dabei. Das Wegenetz war mindestens so verwirrend wie das auf dem Karlsruher Hauptfriedhof. Und ständig hatte er hinter sich einen Franzosen, dem das alles viel zu langsam ging.
Dienstag, 28. August 2018
Am sehr späten Nachmittag fuhren wir nach Les Baux (tatsächlich ohne e) südlich von Saint-Rémy. Das ist eine mittelalterliche Siedlung unterhalb einer auf einem Felsplateau errichteten Burg, von der nur noch Reste geblieben sind. Seit U. zuletzt (vor dreizehn Jahren oder so) hier gewesen ist, hat sich vieles verändert. In die ehemals verlassenen und rekonstruktionsbedürftigen Häuser sind Souvenirläden, Eisdielen, Art-Galerien und so weiter eingezogen. Und zum Burg-Areal wie auch zum Felsplateau, von dem aus man einen weiten Blick ins Land tun kann, kommt man nur noch gegen Zahlung von Wegezoll in Höhe von 10,50 Euro. Wir zahlten und bereuten es nicht. Wenn man auf dem doch recht weitläufigen Terrain sämtliche Ausblicke genießen und jeden über Treppen erkletterbaren Mauerrest erklettern wollte, bräuchte man für den ganzen Parcours wohl an die zwei Stunden. Wir begnügten uns mit einer Fünfzig-Minuten-Fassung, die für unseren Bedarf mehr als ausreichend war.
Da am Abend schon wieder gegrillt werden sollte, kauften wir im Supermarkt von Saint-Andiol die bewährten Rindersteaks. Bewährt hatte sich, wie wir fanden, auch unsere Technik bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben: L. übernahm die erste Schicht und etwa eine Stunde später nahm U., die bis dahin geschlafen hatte, seinen Platz an der langen Tafel ein, während er, L., sich zurückzog, um zu duschen und das Abendprogramm ab 22:30 Uhr (Vorlesen kombiniert mit Nachzeichnen oder TV-Sehen) vorzubereiten. Leider war U.s mit (falsch berechneter) Verzögerung auf den Grill gelegtes Stück Rindfleisch wegen fehlender Hitze nur „medium“ geraten und somit für unser Daführhalten eigentlich ungenießbar. Man hört dann immer das Märchen vom halbrohen Fleisch, das einem auf der Zunge zergehe. Weder U. noch L. haben jemals erlebt, dass ihnen so ein rötlich-zäher, wässrig-gummiartiger Klumpen auf der Zunge oder sonstwo zergangen wäre. Kaum ist L. im Appartement verschwunden, umsorgt Bernd die neben ihm sitzende U. fürsorglich mit herrlich schmeckendem Rauke-Tomatensalat und einer extra für sie aufgehobenen Ofenkartoffel.
Nun ist die Stunde der Wahrheit gekommen, denkt U. und fragt die Autokennzeichen-Karlsruher, wo in Karlsruhe sie denn wohnten. Tatsächlich ist es noch schlimmer als befürchtet: Sie kommen in Wahrheit aus Nagold, zwei Ortschaften weiter als Calw. Schreck lass nach, U. findet sich unversehens in einem Gespräch über ihre Arbeitsstätte wieder, das sich nicht nur um die Stadt Calw, sondern auch um die Musikschule dreht. Die Nagolder Zahnärztin Antje spielte in ihrer Jugend Blockflöte und Klavier, ihr Bruder sei bei den Aurelius Sängerknaben gewesen. Ob U. Dieter Haag (das war bis vor zwei Jahren der Leiter der Musikschule) kenne? Nicht zu fassen. Das Auto ist übrigens ein Dienstwagen, ihr Mann Thomas arbeitet in Karlsruhe-Hagsfeld. So kommt es, dass sich U. mitten in der Provence mit Thomas über die verschiedenen Straßensperrungen im Schwarzwald unterhält und wie man am besten von A nach B, beziehungsweise vom Nagoldtal nach Karlsruhe kommt.
Mittwoch, 29. August 2018
Fuhren nach zwölf Uhr nach Saint-Rémy. Auf Google-Maps hatte L. einen großen, kostenlosen Parkplatz entdeckt, dessen Zufahrt, wie sich herausstellte, ziemlich versteckt liegt. Ist das Absicht? Wir finden ihn problemlos und folgen all den anderen, die ihren Karossen entstiegen sind, durch ein Gewirr von Gassen ins Zentrum. Die Marktleute fingen gerade an einzupacken. Nachdem die Supermarkttomaten aus Saint-Andiol ebenso nach nichts schmeckten wie zu Hause und Bernd sagte, Gemüse dürfe man nur auf dem Markt kaufen, hatte U. die bayrische Susanne gebeten, ihr vom Markt Tomaten mitzubringen. Die Tomaten waren also delegiert und die Dies-und-Das-Einkaufswünsche waren auf dem Markt in Eygalières hemmungslos befriedigt worden, weswegen wir ohne einen Blick auf die Marktstände das Städtische Museum ansteuerten. Irgendetwas von van Gogh stand außen dran, natürlich.
Kaum treten wir ins Foyer, wendet sich uns die Empfangsdame hinter dem Tresen zu und lässt in horrendem Tempo irgendetwas Französisches auf uns los. U. fragt freundlich: „In English, if possible?“ – „Why not!“ antwortet die Gebieterin über den Ein- und Ausgang, lächelt triumphierend und holt tief Luft. In einem ungeheuren Tempo sagt sie, dass, wenn wir originale Van-Gogh-Bilder erwarten würden, wir hier an der komplett falschen Adresse seien. Falls wir das Musée Estrine dennoch besuchen wollten, gebe es hier im ersten Obergeschoss die hauseigene Sammlung, im Erdgeschoss eine temporäre Ausstellung von Bernard Buffet und eine sehr informative Ausstellung über van Goghs Leben, seine verschiedenen Arbeitsphasen und Stilrichtungen, seine Freunde, seine Briefe an den Bruder Theo, seine Zeit in Saint-Rémy und darüberhinaus zwei Filmbeiträge. Der ganze Redeschwall dauerte etwa fünfzehn Sekunden.
Also besichtigten wir der Reihe nach: die Sammlung, einen Saal mit Bildern von Albert Greizes, die Sonderausstellung mit einigermaßen lachhaften Gemälden von Bernard Buffet (sie muten einen an wie Produktions-Muster für spätere Touristengalerien) und natürlich die sehr informative Schau über van Gogh (siehe oben). In der Sammlung fanden wir dies und das, was wir gut fanden. Zwei subtile Bleistift-Gemälde (um 1970) von Henri Goetz hatten es L. besonders angetan. Im Niemandsland zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, murmelte er anerkennend.
Zwar wissen wir hinterher nicht genau, ob sich dieser Museumsbesuch wirklich gelohnt hat, aber immerhin haben wir eines besucht und können nun zusammen mit Glanum zwei Sternchen auf unsere Kulturkarte malen.
U. hat Hunger, L. nicht. Auf der Suche nach einem Bistro mit etwas Kleinem zum Essen werden wir im ganzen Städtchen nicht fündig. Entweder gibt es Eis-und-Crêpedielen oder Restaurants, in denen nichts unter 17,90 zu haben ist. So groß ist der Hunger nun auch wieder nicht. Das kann nur ein Kartell sein, denken wir, hier müsste mal die Wirtschaftskommission der EU einschreiten (wozu hat man einen Cousin in Brüssel bei der EU?). Nicht einmal ein Bäcker mit Sandwiches ist zu finden. Schlussendlich landen wir in einem „Grand Café“ und bestellen einen Salat, zwei Expresso (die Franzosen können nicht anders, wir haben uns an das falsche x und das fehlende s gewöhnt) und Wasser. Die Platanen bilden ein Dach über uns, der Bediener ist professionell und freundlich, der Kaffee ganz gut, der Salat seltsam, direkt vor unserem Tisch donnern Lastwagen und der Durchgangsverkehr vorbei.
In unserem Supermarkt in Saint-Andiol kaufen wir keine Tomaten, aber Weißwein, Rotwein, Käse, Baguette und Chips, das Wichtigste eben. Kaum sind wir zurück, bringt Susanne die Tomaten vom Markt, die ganz und gar genauso aussehen, wie die aus heimischen und französischen Supermärkten. Susanne strahlt und berichtet, sie habe für sich diese knubbeligen Fleischtomaten gekauft, die es bei uns nicht gebe. Fassungslos strahlt U. zurück und gibt ihr zwei Euro dreißig, mehr Kleingeld haben wir gerade nicht. „Passt schon“, meint Susanne, „hat 2,50 gekostet“. Am Abend soll es Nudeln mit Tomatensoße und Mozzarella geben. Zuvor gibt es aber noch eine Art Gewitter mit ein paar den Wolken entronnenen Wassertropfen.
U. bekommt die super Markt-Tomaten dann kaum geschnitten, so hart sind sie. Innen blass, außen schön rot und tatsächlich noch geschmackloser als alle uns bisher untergekommenen Supermarkt-Tomaten.
Donnerstag, 30. August 2018
Nach mehrwöchiger Pause beschließt L., wieder einmal eine Smartphone-Zeichnung zu machen. Autodesk hat sein Sketchbook-Programm selbstverständlich schon wieder „verbessert“ und den Knopf zum Abstellen der automatischen Updates hat L. noch nicht gefunden. Auch sucht er nicht wirklich danach, weil er nicht weiß, ob er die Auto-Updates tatsächlich unterbinden will – schließlich möchte er ja up to update bleiben. So verschafft er sich ohne es wirklich zu wollen einen ersten Überblick über die neuen Möglichkeiten, keine Linie zu ziehen – und fühlt sich danach erschöpft und demotiviert. Was jetzt noch fehlt, sind Optionen wie „à la van Gogh“, „im Stil von Cézanne“, „früher Mondrian“, „später Monet“ und so weiter. Dennoch gelingt es ihm irgendwie, U.s rechten Fuß irgendwie zu zeichnen. Zuvor hatte er nach einem Tool zum Zeichnen von rechten Füßen (weiblich) gesucht, aber keines gefunden, nicht ein einziges.

Am späten Spätnachmittag fuhren wir in den großen Supermarkt nach Châteaurenard, denn zum Abendessen sollte es Fisch geben. Die anderen grillten schon wieder. Unseren Fisch konnte man zum Glück nicht grillen.
Freitag, 31. August 2018
Die Zeit im Paradies neigt sich dem Ende zu. Zwar endet der Aufenthalt nicht morgen – Bernd hat uns angeboten, bis Sonntag zu bleiben, um dem Ferienrückreisesamstagsstau zu entgehen –, aber U. verspürt gegen Ende solcher Aufenthalte im Paradies immer wenig Neigung, selbiges zu verlassen. Der Wind hat wieder aufgefrischt, die Pappeln rauschen herrlich, die Wiese lockt. Mit das Schönste ist das Sich-Aufhalten im Freien, kein Balkondach und nur Himmel über dem Kopf. Also genießen, lesen und bräunen wir, U. tatsächlich eineinhalb Stunden in der Sonne, im Schatten ist es wegen des Mistrals eher kühl. L. zittert eine Knoblauch-Knolle ins Skizzen-Büchlein und grübelt über einem Satz von Emil Cioran: „In den Ekstasen der letzten Daseinswurzeln erblicke ich nur eine Form des Irrsinns, nicht der Erkenntnis.“

Südwestlich von Saint-Andiol erstreckt sich ein kleiner Höhenzug, eher ein Hügelzug: die Crau. Wir waren sie schon etliche Male auf dem Weg nach Saint Rémy entlang gefahren. Es gab dort sogar einen Spazierweg, wie wir von Bernd erfahren hatten. Im schönsten Spätnachmittagslicht zogen wir los, stellten unseren Kombigolf wie uns von Bernd geraten worden war auf dem Grünstreifen direkt neben der Fahrbahn ab (das hätten wir in Deutschland nicht gewagt), überquerten die Straße und fanden jenseits derselben tatsächlich einen Weg, der auf die Anhöhe führte, wobei wir zunächst einen Kanal überquerten.
Die Kanäle sind die beständigen Begleiter des Wegenetzes. Außerhalb der Städte finden sie sich an nahezu allen Straßen und sie führen viel Wasser. Das kann nicht nur Entwässerungswasser sein, wo kommt hier in der Ebene das viele Wasser her? Vom Hausherrn erfahren wir, dass das Kanalsystem der hiesigen Gegend von der Rhone (oder doch der Durance?) gespeist wird. Einmal im Jahr trifft sich der Bauernverband und handelt aus, wieviel Kubikmeter jeder Bauer für die Bewässerung seiner Felder entnehmen darf.
Wir gehen den Weg hinauf auf die Anhöhe, haben aber nicht vor, bis Saint Rémy zu spazieren, was wohl möglich wäre. Stattdessen begnügen wir uns mit einer halben Stunde hin und einer dreiviertel Stunde zurück (es gibt nur einen Weg, der kein Rundweg ist). Auf der einen Seite reicht der Blick bis zu den Hügeln der Alpillen, auf der anderen Seiten sehen wir die Reihen einer Olivenplantage, die, wie wir später erfahren, Caroline von Monaco gehört. Dann wird sehr wahrscheinlich sie (wer sonst) die Fahrerin des großen schwarzen Jeeps gewesen sein, der das Plantagengelände verließ, gerade als wir uns entschlossen kehrt zu machen.
Nach der Rückkehr halbstündiges Palaver mit Bernd, Udo (dem Stützstrumpf-Vertreter), Thomas (der uns ein Glas Sekt anbot) und der Zahnärztin Antje. Über Kompressionsstrümpfe, Krampfadern und die Personalprobleme der Zahnärztinnen-Praxen. Der Mistral wird stärker.
Samstag, 1. September 2018
Nach dem Frühstück verabschiedeten wir Udo, den Kompressionsstrumpfverkäufer aus dem Saarland. Dazu brausten die Bäume im Nordwind, der immer stärker wehte. Erst ab 19 Uhr sollte sich der Wind allmählich legen.
L. las den ganzen letzten Ferienhaus-Tag über immer mal wieder in Ciorans „Gipfeln der Verzweiflung“. Würde sich gut für eine Lesung mit Musik eignen, sagte er: „Apotheose des Nichts im Kontrast zu musikalischer Schönheit.“ Am Nachmittag gingen wir zum Einkaufen nach Saint-Andiol und machten zuvor einen kleinen Rundgang durch noch nicht durchschrittene Straßen.


Und nach einem letzten abendlichen Sonnenbad begannen wir damit, uns auf die Abfahrt am nächsten Tag vorzubereiten.
Sonntag, 2. September 2018
Machen wir es kurz: Der Tag begann mit Packen und Abschiedsszenen und endete vor dem heimischen Fernseher, auf dessen Bildschirm eine Montalbano-Folge (DVD) zu sehen war. Dazwischen lagen mehr als neun Stunden (840 km) Autobahn-Fahrt.